Sur le pont d’Avignon. Ja, was ist da eigentlich, auf der Brücke in Avignon? Das habe ich mittlerweile vergessen. Dafür weiß ich, was unter den Pariser Brücken ist. Aber lassen Sie mich von vorn anfangen: In Montmartre, da riecht es nach ranzigem Abfluss; man erwartet jeden Moment eine Armee von Kakerlaken aus der Küche herausmarschieren, sich auf den Weg zum Bett machen, hochkrabbeln und über die Bettdecke bedrohlich näherkommen. – Die kleine Wohnung aus dem Internet war nett und gemütlich, zentral gelegen, und ja, die Vorgänger dieser Unterkunft hatten den verstopften Abfluss in der Küche erwähnt. Das Gammelaroma entfaltete sich beim ersten Geschirrspülen in der kleinen ohnung und passte so gar nicht zu dem Paris-Feeling, das ich in meiner Naivität erwartet hatte. Mit meinen herausragenden Problem Solving Skills hatte ich, ruckzuck, eine Lösung für das sich in meinen Nasenlöchern manifestierende Problem parat: das Waschbecken in der Küche ab sofort nicht mehr benutzen.
Zwei Tage darauf ging es wieder – ich spülte mein Geschirr fortan im Bad neben der Toilettenschüssel.
Auf dem Place du Tertre mitten in Montmartre, da tobt das Leben. „Les artistes“ buhlen um „les touristes“. Der eine da hinten, der mit der Baskenmütze, blickt neckisch in meine Richtung, möchte mich malen, porträtieren, karikieren, begeistern, kann jedoch nicht viel ausrichten. Für 4,50 Euro habe ich mir mit vielen weiteren Hühnern, die mit mir auf der Stange sitzen – an den kleinen Tischen der Cafés, die den Platz säumen –, mit dem Rücken zu den Lokalen, eine Sitzgelegenheit erkauft. Für die Dauer einer Cola. Außerdem beschäftigen mich ganz andere Sachen als Kunst: Ich muss mal; Zähne putzen könnte ich auch mal wieder.
Während ich in dem kleinen Klo meine Zahnbürste auspacke, rüttelt es bereits an der Klinke. Oh Mann. Ich nestle an dem Reisekulturbeutel, die Zahnpasta fällt heraus. Es rüttelt erneut. Mein Gott, man wird doch wohl noch in Ruhe …!
Das Rütteln wird zu einem Gezerre, denn offenbar kann die Person auf der anderen Seite es nicht glauben, dass außer ihr noch jemand ein dringendes Bedürfnis haben könnte. Nämlich das, Zähne zu putzen. Geschlagene fünf Minuten später verlasse ich das Örtchen und blicke in ein erstauntes Gesicht, murmele etwas von „C’est la vie“ und räume das Feld.
An der Gare du Nord eine Spontanflirtszene: Ein „jeune homme“ macht einer „dame“ den Hof. Sie, die Ärmste, schleppt sich an ihrem Koffer ab. Besagter „jeune flirteur“ eilt am Fuße der Treppe zur Hilfe. Auch wenn barrierefreie Bahnsteige noch nicht in Paris angekommen sind, die Emanzipation ist es schon. Die Dame reißt ihren Koffer an sich, schleppt weiter, der Typ läuft ihr unbeeindruckt hinterher. Mit letzter Kraft hievt sie das klobige Ding in die Métro und steigt ein, er tut es ihr nach, bleibt in der Tür stehen, hält sich mit beiden Armen rechts und links elegant am Rahmen fest, will was sagen. Ich möchte nach Möglichkeit ebenfalls rein, kann nicht, weil er den Zugang versperrt, stupste ihn an. Das bekommt er natürlich nicht mit, weil er damit beschäftigt ist, weiter auf seine Angebetete einzureden. Es piept. Er gibt auf, als sie ihm die kalte Schulter zeigt, springt zurück, stolpert über meinen Fuß, steht auf, richtet seine Mütze. Die Bahn fährt davon. Ohne mich.
Den Eiffelturm brauche ich mir nicht anzusehen – er wird sich in den vierzehn Jahren meiner Abwesenheit nicht verändert haben. Kurz darauf stehe ich doch am östlichen Stahlfuß. Wie soll ich das jetzt erklären … eine alte Touristengewohnheit. Auch alle anderen sind ihr nachgegangen und strömen auf diesen Brennpunkt zu.
Brennpunkt trifft es genau. Eine Mutter streitet sich mit ihrer Tochter auf Polnisch darüber, wer mit wem aufs Bild darf. Keine leichte Frage, das muss auch ich zugeben. Weiter hinten ist ein Vater auf Niederländisch genervt, weswegen, kann ich nicht genau verstehen. Irgendjemand will nach Hause.
Der Eiffelturm sieht noch genauso aus. Ich beschließe, die Reise zu einer kulinarischen zu machen, statt weitere Sightseeing-Kerben zu sammeln. Natürlich, ein paar Postings auf Facebook wären nicht verkehrt. Ich habe lange nichts gepostet und meine Freunde könnten den Eindruck gewinnen, mit mir ginge es bergab. Ein Selfie mit dem Glöckner von Notre Dame beispielsweise wäre da eine geeignete Abhilfe. Aber nein! Der Entschluss ist gefasst.
Ich kehre in einem weinbewachsenen Restaurant ein, mit bunt bemalten Fenstern und schweren roten Vorhängen, ein verwunschenes Häuschen, aus dem ein Stimmengewirr entweicht. Nach zehn Minuten Wartezeit ist für eine weitere Stimme Platz und ich werde an meinen Tisch gebracht. Dem Nebentisch bringt der Kellner die Speisen und erklärt: Chicken, Fish, Beef, Pasta. Die Asiaten sind verwirrt, wissen offensichtlich selbst nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Teller werden herumgereicht, getauscht, weitergeschoben. Dann ein Schmatzen, das meinen ersten Eindruck bestätigt: Hier schmeckt es.
Ich habe Fahrt aufgenommen und beginne meinen zweiten Tag in einem bretonischen Restaurant. Mit einem Buchweizenpfannkuchen, der mit allem belegt ist, was die bretonische Küche so hergibt: Schinken, Spiegelei, Speck, Spinat, Zwiebeln, Champignons, Walnüssen, Roquefortsauce, Ziegenkäse. Dazu eine Boulée de Cidre.
Ein grober Fehler! Nicht weil es erst 13 Uhr am Nachmittag ist, nein. Bekanntlich ist Alkohol harntreibend, und das stellt in dieser Stadt ein mittelschweres „problème“ dar. Laut Reiseführer finden sich Toiletten an jeder Straßenecke. Das stimmt! Empfehlen kann ich die Automatikklos dennoch nicht einmal Ole, der mich in der zehnten Klasse gehänselt hat. Oder soll der Arme an einer Atemvergiftung sterben, bloß weil die Spülung seit achtundvierzig Stunden nicht geht? Soll er später jemandem seine unhygienische Hand reichen, bloß weil das Wasser nicht funktioniert? Und Sie wollen ja sicher auch nicht just in dem Augenblick vorbeigehen, wenn sich die Eisentür wegen eines Softwarefehlers öffnet, während er mit heruntergelassener Büx auf dem Lokus hockt. Oder?!
Ich gebe meinen Schlendergang durch die Nebengassen auf, will zurück ins Getümmel, muss mich ernsthaft auf die Suche nach einer Toilette machen. In einem Eckcafé schließe ich einen Deal mit dem Kellner: Ich bestelle einen Kaffee und darf aufs Klo. Ich beschließe, so lange sitzen zu bleiben, bis das Genussmittel die Nieren passiert hat, gebe dann doch auf und stehe eine halbe Stunde später wieder vor demselben Problem. Oder vielmehr in der Toilettenschlange des „etwas anderen Restaurants“ an den Champs Elysées. Man mag es nicht glauben: Hier darf man völlig kostenlos und ungeniert pinkeln – sofern man sich nicht vorher in der Schlange, die bis zur Mitte des Restaurants reicht, in die Hose gemacht hat.
Ich beschließe von nun an nichts mehr zu trinken. Das klappt ganz hervorragend – bis zu dem Punkt, in dem mir schummrig vor Augen wird. Dehydration. Allerdings wäre es zu riskant, jetzt einfach so seiner Trinklaune nachzugeben, mitten in der Stadt, ohne Einkehrpunkt und Rettungsanker. Ich reiße mich zusammen und erreiche die „Brasserie vagenende“. Sehr edel und gediegen. Sehr leer.
„Où sont les toilettes ?“, sind meine ersten Worte. Diesmal möchte ich aus dem Wasserhahn saufen; es eilt. Der Kellner deutet diskret nach links.
Nach meiner Rückkehr steht er noch genauso gelangweilt und in weißen Handschuhen zwischen den dunklen filigranen Holzmöbeln. Ich setze mich, bestelle etwas zu trinken. Und ein Chateaubriand, gespannt auf das Original. Die Fälschung gab es im polnischen Highclass-Restaurant „Polonia“ in Gdynia, wo Milan, Ola und ich beinahe täglich abhingen, dort von dem Garderobenmann mit den dicksten Brillengläsern in ganz Gdynia begrüßt wurden und jedes Mal ein Chateaubriand bestellten. Die Höflichkeit des Garderoben-Maulwurfs blieb bei jedem Besuch auf konstantem Niveau, auch an der Dicke seiner Brillengläser änderte sich nichts, dafür fiel das Chateaubriand jedes Mal anders aus, je nach Tageslaune des Kochs. Es war ein Ratespiel: Was würden wir diesmal auf dem Teller haben? Steckte das Fleisch in zwei Toastbrotstücken? Gab es geschmolzenen Käsen oben drauf? Mit Sauce oder ohne? Wir wurden des Spiels nicht müde, bestellten immer und immer wieder dasselbe und bekamen stets was anderes.
Das Pariser Chateaubriand fiel normal aus, keine Auffälligkeiten. Die entsprechende Note bekam es durch die an der Wand hängenden, in Holz eingefassten überdimensionalen Spiegel, durch das in der Ecke stehende Grammophon und die gedämpften Stimmen der wenigen Gäste, die diesen Rückzugsort aufgesucht hatten. Fast kam ich mir vor wie eine Pariser Dame, da klingelte überraschend mein Handy – wie undamenhaft; ich drückte den Störenfried weg und bestellte schuldbewusst eine Crème brûlée, obwohl ich schon vor dem Hauptgang eigentlich keinen Hunger gehabt hatte. Allein der Durst hat mich hierhergetrieben.
Die Crème landet kurz darauf vor mir und noch während mein Löffel durch das letzte Krustenstück bricht, konfrontiert mich der Kellner mit der Rechnungsfrage. Oh nein, so schnell wirst du mich nicht los, Bürschchen. Gerade fange ich an, mich an das exklusive Ambiente zu gewöhnen. Ich frage nach einem Kaffee – der im Nu auf dem Tisch steht. Die Bedienung legt nonchalant die „addition“ dazu – eins zu null für ihn. Für schlappe 48 Euro habe ich ein ganz neues Paris-Gefühl – und der Kellner ist mich endlich los, kann wieder herumstehen.
An das vornehme Leben gewöhnt, finde ich mich am nächsten Tag im Relais d’Entrecôte wieder, dem einzigen Laden in der Stadt mit Entrecote-Flatrate. Ich weiß jetzt, worauf es ankommt: nämlich einen Schein nach dem anderen zu zücken und sich keine Sorgen ums Morgen zu machen. Nicht wie damals als Studentin in Dänemark, wo ich am Hot-Dog-Stand vor lauter Geiz einen „Krassen“ bestellte; der war so krass, dass nicht einmal ein Würstchen zwischen den beiden länglichen Brötchen steckte. In Paris konnte das nicht passieren; mittlerweile gehöre ich zum arbeitenden Volk.
Die Speisekarte ist handgeschrieben, in verschnörkelter Schrift; ich kann kein Wort entziffern, habe aber eine Ahnung und gebe meine Bestellung auf: „Einmal, bitte.“
Man nickt mir zu; wenige Augenblicke später steht mein Essen auf dem Tisch. In einem Abwasch bekommt der Nachbar ein weiteres Stück Fleisch und Pommes auf den Teller geschüttet – man scheint hier empfindlich zu sein, was nicht konsumierende Gäste angeht, die dem Müßiggang frönen und sich beim Essen nicht ranhalten. Vor dem Eingang wartet die Menge auf einen frei werdenden Platz. Links von mir gehen schon welche, die dabei waren zu bestellen, als ich ankam. Ich fühle mich unter Druck, obwohl ich erst fünfzehn Minuten hier bin.
In gewohnter Manier will ich den Orangensaft, den ich zum Essen dazubestellt habe, schütteln, aber in Frankreich ist alles anders: Für den Fall, dass ich schwächeln sollte, hat man in der Küche den Flaschendeckel bereits gelöst, der Inhalt der von mir umgedrehten Flasche landet auf dem Entrecote und den Pommes – peinlich berührt mampfe ich weiter, als sei nichts geschehen. Es hat etwas von Ente à la orange. Die Kellnerinnen sind wachsam, bemerken das Malheur und wollen mir neue Pommes mit Fleisch auf den Teller schaufeln. Ich winke ab, suche mir stattdessen einen Turm aus Baiser und Eis aus – dank der Bilder auf der Dessertkarte fällt die Auswahl leicht. Sehr instagramfähig, das Dessert – fast bereue ich, kein Mitglied des Portals zu sein. Dort hätte ich all meine Freunde um Rat fragen können: Wie, liebe Follower, verspeise ich jenes fotogene Ungetüm am besten? Welche Strategie empfehlt ihr, was hat sich in der Praxis bewährt? Heute jedoch muss ich allein zurechtkommen. Ich kippe den Turm auf die Seite, verputze das kreative Chaos und räume meinen Platz.
Man kann nicht den lieben langen Tag essen, essen, essen. Deshalb gehe ich spazieren. Und stelle fest, dass es in Paris riecht. Nach Urin, um genau zu sein. Meist in den abgelegenen Ecken, leider auch am Place de la Bastille, an manchen Sehenswürdigkeiten, immer mal wieder hier und dort. Wie zu Zeiten Ludwigs XIV, wo man entspannt in die Ecke urinierte und an Parfums nicht sparte. Ja, so ist es auch heute. Selbst in den Galaries Lafayette, wo ich ein billiges Paar Schuhe für 400 Euro ausmache, riecht es auf den Toiletten eher nach Pisse denn nach Parfum. Paris, das Pissoir Europas.

Am Tag darauf, im Randbezirk von Montmartre, schlendere ich an einem Imbiss mit dem wohlklingenden Namen „Grill Urea“ vorbei – ist bestimmt Arabisch für „leckeres Essen“. Ich erinnere mich an den definierten Zweck meines Paris-Aufenthaltes und steuere das Café de Varenne an, den Geheimtipp eines Bekannten, mit „prix raisonnables“, vernünftigen Preisen.
Hier trifft man echte Pariser. Der Kellner steht im Türrahmen und schaut nach draußen und draußen, da gießt es gerade – eine triste Pariser Szene wie aus dem Bilderbuch. Schnell schlüpfe ich hinein. Am Tresen stehen einige Personen, die einen Kaffee herunterkippen. Ich setze mich, und für 18 Euro ist das Confit de Canard meins. Man unterhält sich mit der Tresendame über Politik. Ich höre was von „Impôts, impôts !“. Die Diskussion über Steuern wird so lebhaft, dass einer der stehenden Männer sich vom Tresen löst und dem Paar, das gerade an einer Tartellette maison aux fruits rouges sitzt, seine Sicht auf die Dinge darlegt. Die beiden nicken bedächtig; trotzdem ist er nicht zufrieden und setzt verbal einen drauf, tippt mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte. Das war der Schlusspunkt; er geht zurück an den Tresen. Ich bleibe länger sitzen, will abwarten, bis der Regen vorbei ist, um durch Paris zu flanieren, doch der kooperiert nicht und zwingt mich dazu, heute mal kulturell zu werden.
Es ist alles zu etwas gut, hätte meine Oma jetzt gesagt: Ich betrete den Louvre. Auf dem Weg zur Mona Lisa – wo sonst sollte ich hinsteuern? – durchschreite ich mehrere Klimazonen: eine subtropische, in der sich dicke ältere Frauen Luft zufächern, bis zu welchen, wo es kühl und still ist. Der Fußverkehr in dem langen Saal wird dichter; es kann nicht mehr weit sein. Da rechts, da stehen sie, rücken zusammen, vor einer Wand. Nein, vor dem Bild der Bilder. Die einen drängen nach vorn, andere wollen aus dem Getümmel wieder hinaus. Es herrscht ein rauer Umgangston. Irgendjemand fährt seine Begleitung an, dass er nur das verdammte Foto schießen möchte. Diesmal auf Deutsch. Jeder will ein Foto von Lisa. Oder ein Selfie mit Lisa. Nur ich, ich will es nicht und verschwinde eilig in eine andere Klimazone, mache vorher ein Bild von den Fruchtgesichtern, die in der Nähe herumhängen, um nicht mit leeren Händen zu gehen.
Die Schilder zeigen den Weg zur Venus von Milo auf. Ein ähnliches Gedränge hier, bloß ist die Venus größer und deshalb besser sichtbar. Jemand hat länger nicht geduscht. Das erinnert mich an das allgegenwärtige Hygieneproblem und mir fällt ein, dass ich die Toilette in dem Flügel aufsuchen könnte – die selbstverständlich geschlossen ist. Man verweist auf die Haupttoilette. Sodom und Gomorrha herrschen dort, natürlich. Handtuchpapier auf dem Fußboden – ach, ich erspare Ihnen das.
Der letzte Tag in Paris gibt sich noch einmal Mühe. Ich schlendere durch das Marais-Viertel. Fassaden, immer wieder Fassaden. Je oller, je doller. Manche Fensterläden lassen sich nur unter schwerem Knarren öffnen, wie die Einwohner beim morgendlichen Ritual eindrucksvoll demonstrieren. Wunderschön. Schließlich der letzte Schuppen, „Le Chardenoux“, ein Lokal „très chic“, in dem man im Eingangsbereich warten muss, weil so beliebt. Der Kellner legt die englischsprachige Speisekarte vor mich. Ich winke pikiert ab; nicht notwendig. Acht Jahre Französischstudium, Monsieur! Folgsam bringt er die französische Karte und ich bemerke das Malheur: Das hier haben wir im Studium nicht durchgenommen! Ich habe nicht einmal eine Ahnung, ob es sich bei den Finessen jeweils um Fisch, Fleisch oder Geflügel handelt. Fish, Chicken oder Beef?
Beim nächsten Vorbeigehen des „garçon“ gestehe ich ihm zerknirscht meinen Irrtum; mit einem triumphierenden Blickt reicht er mir die englischsprachige Karte. Ich entscheide mich für das volle Programm und wähle ein Entree, das viel zu kompliziert ist, um es an dieser Stelle aus dem Kopf herzusagen. Außerdem kann ich mir selbst auf Englisch nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Ente soll drin vorkommen. Und Leber.
Als „plat“ etwas mit „volaille jaune“, gelbes Hähnchenfleisch, aha. Zum Dessert warme Datteln. Derweil sich der Koch in der Küche an seine Kreation macht, schaue ich durch die verglaste Eingangstür der Brasserie hinaus auf die Straße, wo es wieder in Strömen regnet, nippe an meinem Weinglas, das mit Mineralwasser gefüllt ist, sitze im Warmen und komme mir vor wie die Hauptdarstellerin in einem französischen Streifen. Die Zigarette fehlt – am besten mit lässiger Zigarettenspitze. Es ist auch nebensächlich, wo sich in dem aufgeschäumten Etwas, das vor mich gestellt wird, eine Entenleber verstecken soll. Hier geht es um Höheres.
„Il pleut encore“, bemerkt einer beim Hinausgehen. Ja, es regnet noch. Und ich muss pinkeln.
Stinkt dir Paris? Dann reise doch nach Asien:
Näher am Äquator
Nackt in der großen Stadt
Pekingente, pikant
Oder bleib gleich in Deutschland:
Welcome to Üdersdorf
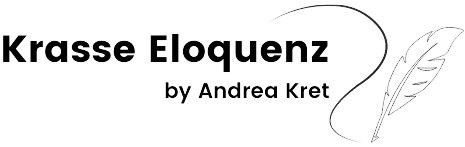



Pingback: 450 Kilometer näher am Äquator - Krasse Eloquenz
Pingback: Der Hund mit dem Winkepfötchen. Eine Flughafen-Story. – Krasse Eloquenz
Pingback: Ballaballamann – Krasse Eloquenz