Es war nicht leicht, hierher zu gelangen. In dieses Internetcafé, an diesen Computer in der Andingmennei Dajie in Peking. Zuvor galt es, einige Pseudodruckereien, die in der Straße verstreut waren und in denen alte Männer oder Kinder vor Bildschirmen saßen, abzuklappern.
„Internet?!“, fragte ich dort immer wieder hoffnungsvoll und erntete verständnislose Blicke. Kein Internet also. Und dann dieses Cybercafé, das ich erst beim dritten Abgehen der Straße entdeckte und in dem ich nun nach „Schweinegrippe China“ recherchierte. Ich fühlte mich überwacht – vom chinesischen Staat, vom Cafébesitzer, vom Nachbarn am Nebencomputer. Daher recherchierte ich auf Polnisch: „świnska grypa chiny“. Sicher ist sicher. Ja, die Schweinegrippe hatte China bereits erreicht, erfuhr ich auf den polnischen Seiten. Ich fuhr den Computer herunter, machte ihn fix aus, war drauf und dran, zu verschwinden – und blickte bei Hochkommen direkt in ein grinsendes Gesicht.
Es gehörte Henry. Henry war mein Tischnachbar, nicht etwa Brite, sondern waschechter Chinese, der in einem Souvenirshop am Yonghegong-Lamatempel arbeitete und seine Freizeit mit Computerspielen verbrachte, so wie jetzt – erfuhr ich in der ersten Minute der Begegnung. Er konnte mir noch viel von sich erzählen, doch zuerst wollte er alles von mir wissen, überschüttete mich mit Fragen. Sehr skeptisch ob meiner bisherigen Begegnungen mit dem chinesischen Volk, gab ich lediglich die Basics preis: Deutschland, drei Wochen in China, schönes Land, ja. Nicht verheiratet, nein. Ich ließ mir seine Nummer geben und versprach, mich zu melden, ja, ja.
Was früher passierte als gedacht. Auch in der siebzehnten Chinanacht war der Jetlag mein treuer Begleiter. Ich zappte mich durch CNN und Wirtschaftsnachrichten mit wirren Diagrammen und Grafen, mit Männern im besten Alter, die darüber diskutierten, ob in China irgendwo ein Sack Reis umgefallen war. Immerhin besser, als sich im Bett herumzuwälzen. Ich zappte weiter und landete bei den chinesischen Schnulzen auf MTV, wo so einige sich die Seele aus dem Leib sangen. Man sang von den Verflossenen, die man verlassen hat oder die einen verlassen haben, erinnerte sich an alte Zeiten, tauschte sehnsuchtsvolle Blicke. Och wie schön ist es doch gewesen – illustrierten die Bilder im nächsten Clip –, als man noch zusammen war; eine Titanic-hafte Pose zur Unterstützung des Gesungenen. Und man selbst ist so ein Idiot gewesen und musste deswegen jetzt mit beiden Fäusten dramatisch gegen die Wand hämmern. Ich war fast ergriffen.
Um 3 Uhr morgens schickte ich Henry eine SMS: Ich würde ihn am übernächsten Tag, einen Tag vor meiner Abreise, am Yonghegong-Lamatempel abholen und ihn zum Essen ausführen. Meine Konditionen, ein von mir ausgewähltes Lokal: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so übers Ohr gehauen würde, war eher gering. Holzauge, sei wachsam. Und ich wusste auch schon, wohin ich Henry entführen würde, um ihm den Chinesen, unplugged, zu entlocken. Einen Chinesen, der mir keine Handtasche oder Uhr verkaufen möchte, einen Chinesen, der mich zu keiner Teezeremonie oder Kunstausstellung von unentdeckten talentierten und dazu naiven Künstlern mitnehmen will. Einen Chinesen aus dem Internetcafé von nebenan halt.
Unweit der Station Hepingmen war ich vor vier Tagen einem interessanten Phänomen auf die Spur gekommen. Da schlenderte ich an einem dichten Gedränge vor dem Eingang zu einem Gebäude vorbei. Ein Hotel konnte es nicht sein, es sei denn, zwanzig Touristengruppen waren gleichzeitig eingetroffen und wollten nun einchecken. Wie Kongressteilnehmer sahen die Leutchen nicht aus, also auch keine Messe. Es war eine bunt gemischte Menge, deren gemeinsamen Nenner ich nicht ermitteln konnte. Ich wollte die nächste schlaflose Nacht nicht damit zubringen, eine Antwort darauf zu finden, was es hier Tolles gab, und so tauchte ich einfach ein in die Menge und begab mich zur Eingangstür.
Schnell wurde mir klar, dass das hier ein Pekingentenrestaurant war. Tausende von Chinesen können nicht irren, dachte ich bei mir und zog – wie auf dem Amt – eine Wartenummer, setzte mich auf einen der einfachen Stühle in der Lobby, zwischen dreißig andere Menschen, die darauf warteten, aufgerufen zu werden. „Die 306 bitte in den dritten Stock“, sprach die Dame am Ende des Foyers ins Mikrofon. „Die 306, bitte.“ Klang zumindest danach. „308 – Sie werden im Erdgeschoss erwartet.“ Die 308, ein kleiner, unsicher dreinblickender Asiate, gefolgt von einer Frau mit Schirm, begab sich in ihre Richtung. „Treehuntred-nein, please second floo.“ Eine Touristenfamilie erhob sich.
So wurden die Wartenden nach und nach auf diverse Stockwerke des Gebäudes verteilt. Leute standen auf, neue nahmen Platz im Wartesaal. Die 306, die ihren Einsatz offenbar verpasst hatte, wurde erneut aufgerufen. Nach zehn Minuten – diese Wartezeit hatte man mir am Eingang in Aussicht gestellt – war ich noch nicht dran. Auch nicht nach dreißig. Nach fünfundvierzig erhob ich mich schließlich und fragte nach. Die Dame mit dem Mikro wechselte zum Walkie-Talkie, empfing darüber Anweisungen und schickte mich in den ersten Stock. Wo bereits eine andere Walkie-Talkie-Dame auf mich wartete und mich in Raum 206 lotste, ein schnörkelloses Zimmer mit etwa zehn Tischen, in dem Feierabendstimmung herrschte. Geschirr wurde weggeräumt, vereinzelt saßen noch Gäste herum. Ich setzte mich, schaute in die Karte, fand darin das eine Gericht, entdeckte den Kellner nicht, schaute erneut in die Karte, dann an die Decke. Holte mein Buch raus. Da fiel der Bedienung des Raums 206 auf, dass ich da war, und ich bestellte eine halbe Pekingente – weniger ging nicht, kategorisches Kopfschütteln.
Ein Koch mit Mundschutz und vorschriftsmäßig hoher Kochmütze erschien mit einem Rollwagen, stellte sich an die Tische. Er begann, die glänzend-knusprige Ente mit einem langen Messer sorgfältig zu tranchieren. Der Nachbartisch mit drei Personen bekam die Hälfte. Die andere war für mich, doch mich vergaß der Kellner, natürlich. Der Rollwagen mit den Köstlichkeiten wurde wieder weggeschoben. Immerhin hatte der Koch nicht nur eine Tranchier-, sondern auch eine gute Beobachtungsgabe und wies den Kellner auf seinen Fauxpas hin. So kam auch ich an meine Entenhälfte. Es begann eine spektakuläre Völlerei.
Die sollte nun wiederholt werden.
Ich hole Henry am Souvenirshop ab, um mit ihm ins Pekingentenhaus zu fahren. Wir rufen uns ein Taxi, Henry macht vom Hintersitz in Richtung Fahrer die Ansage, wohin wir wollen, der Taxifahrer guckt wenig begeistert. Ein wahrer chinesischer Erklärungsregen ergießt sich über meine Pekingentenbegleitung, und erst einige Minuten später erfahre ich, dass der Fahrer unser Fahrziel nicht für besonders gelungen hält. Bei diesem Verkehr würden wir eine Stunde brauchen. „Macht nichts“, sage ich unbekümmert. „Dann können wir uns währenddessen unterhalten.“
Die Unterhaltung fällt weniger angenehm aus als erwartet: Henry, der als Erster ins Taxi gestiegen ist, beweist mir, dass das, was man in Vorlesungen zur Kulturwissenschaft stets hörte, tatsächlich stimmt, nämlich dass der Abstand zwischen zwei Personen, die miteinander kommunizieren, in diversen Ländern geringer ausfällt als in Deutschland. Er fällt in diesem speziellen Fall sogar so gering aus, dass ich froh bin, als ich anfange zu husten. Froh darüber, dass der Husten sich zu einem Hustenanfall steigert, ich nicht mehr aufhören und mich einkriegen kann und mir die Tränen in die Augen schießen. Henry rückt von mir ab. Die Klimaanlage ist es, die meinem Körper, noch vor Kurzem fiebrig und krank, zusetzt. Ich huste weiter, huste immer noch, Henry schaut verstört aus der Wäsche. „You are cold“, sagt er und legte mir die Hand auf die Stirn.
Ja, natürlich habe ich kein Fieber! Auch keine Schweinegrippe; mir wird trotzdem unwohl, wenn ich an ein mögliches H1N1-Fiasko denke, das seinen Beginn in diesem Taxi nehmen könnte. Ich versuche, nicht zu sprechen, gebe nur zu verstehen, dass der Taxifahrer die Klimaanlage herunterdrehen soll. Der macht stattdessen das Fenster auf. Das ist das Ende. Ich versuche, mich zusammenzureißen, huste weiter und schaffe es gerade noch, dem Taxifahrer beim Aussteigen 12 Yuan in die Hand zu drücken, um am Straßenrand weiterzuhusten, während Henry ebenfalls aussteigt. In einer Hustpause stürme ich mit ihm ein Geschäft, um dort etwas zu trinken zu holen, greife im Vorbeigehen nach einer Tüte Bonbons und erwische einzeln verpackte getrocknete Fleischdrops, wie mir Henry erklärt, der die Dinger zurück ins Regal legt. Ich hätte schwören können, dass das Pfefferminzbonbons waren.
Henry will mich an der Hand nehmen, als wir aus dem Laden treten und die Straße überqueren wollen. Ich bemerke es einfach mal nicht. Hingegen bemerke ich schon, dass er vor dem Betreten der Rolltreppe „Achtung, Rolltreppe“ sagt. Und weiter unten, an den Schranken zur U-Bahn: „Hier muss man die Karte reinstecken, damit man reinkann.“ Dass mich nach drei Wochen Bahnfahren in diesem Land endlich einer aufklärt! Ich sage nichts. Beim Einsteigen in den Waggon greift seine Hand nach meiner, aber meine war schneller – und ist schon weg. Wir sitzen in der Bahn, meinem Hals geht es inzwischen ganz gut. Henry konnte im chinesischen Lebensmittelchaos doch noch Pfefferminzbonbons ausfindig machen und wickelt das Bonbon aus dem Papier – für den Fall, dass ich es selbst nicht hinkriege. Ich hoffe nur, dass ich nicht allzu viel sagen muss und meinen Hals schonen kann. Diesem frommen Wunsch wird entsprochen, und wie!
Meine Begleitung ergeht sich in Monologen. Henry schildert mir, wie gro-gro-großartig China sei, wie traditionsreich. Dass er das Traditionelle toll findet, einfach wunderbar, so himmlisch. Er findet Traditionen, Bräuche, Sitten, Konventionen einfach nur gut, erklärt mir, dass China eigentlich anders heißen müsste, lange Zeit anders hieß. Wie, habe ich fünf Minuten später wieder vergessen. Dass er für den Buddhismus lebe, dass er täglich ausschließlich daran denke. Dass dies und dass jenes. Ich nicke wissend und schalte auf Durchzug. Mein Hals erholt sich.
Erst in der Abfertigungshalle des Restaurants muss ich wieder reden. Wir ziehen die Nummer 202, als gerade die 157 aufgerufen wird – eine Info, die mir nun dank Henrys Anwesenheit zuteilwird. Zum Glück ergattern wir zwei freie Stühle und dürfen uns die Zeit bis zur Zuteilung des Raumes mit Plaudern vertreiben. Mit dem Anplaudern gegen den Lärm des Wartesaals. Henry rückt näher, damit ich ihn besser verstehe. Er erläutert die Traditionen in China und ich weiß nicht, weshalb, aber auf einmal ist er beim Thema Haare und fragt mich, ob er meine Haare anfassen dürfe. Mit allen Fragen habe ich gerechnet, bloß mit der nicht. Vielleicht habe ich mich verhört? Aber nein, er hat eindeutig „Can I touch your hair?“ gesagt. Instinktiv rücke ich weg und habe die schlauste aller Entgegnungen parat: „Why?“ Na, einfach deshalb, weil er es mag, Haare anzufassen, meint Henry.
Verwirrt scanne ich mein Repertoire an möglichen Antworten ab und überlege, was man in solch einer Situation sagt, doch in keinem Frauenratgeber wurde ein ähnliches Szenario behandelt. Ich entscheide mich für meine Standardantwort auf ungewöhnliches Verhalten von Menschen aus anderen Kulturen: „We don’t do this in Germany/Europe.“ Keine Zeit, darüber nachzudenken, ob er durch meine Replik sein Gesicht wahren konnte. Das sieht unverändert aus, grinst wie vor zwei Tagen im Internetcafé und ist auch schon wieder näher an meinem. Heute sei ein besonderer Tag, meint er, mein letzter Abend in China. Er freut sich, dass er die letzte Nacht mit mir verbringen darf. Ich wähne mich in einer Titanic-würdigen Schmonzette chinesischer Ausprägung, in einem der MTV-Videos, bin nicht sicher, wohin das Ganze führen soll, entscheide, das später klarzustellen. Ich lächele unsicher und sage erst einmal „Yes“. Vermutlich will er die ganze Nacht mit mir quatschen, weil ich erwähnt hatte, dass ich erst einschlafen kann, wenn es hell wird.
Es bleibt keine Zeit, weiter über die seltsame Bemerkung zu sinnieren; wir werden zu einem Tisch – diesmal im Parterre – geführt. Während die Entenvorbereitungsmaschinerie auf Hochtouren läuft, trinke ich vom Jasmintee, der bereits vor mir steht. Henry gießt mir neuen nach. Ich nehme noch einen Schluck, um die Wartezeit zu überbrücken – das Gespräch über Tradition und Tradition fesselt mich nicht mehr. Der eine raucht bei Langerweile, der Zweite kratzt sich an der Nase, der Dritte starrt an die Decke; ich trinke Tee. Henry schenkt mir wieder welchen ein. Ich mag gar nicht mehr weitertrinken, trinke trotzdem – so eine blöde Traditionen-Redepause. Henry gießt erneut nach. Ich habe genug – sowohl vom Tee als auch von der Bevormundung –, trinke nichts mehr. Die Ente kommt.
Es ist nicht einfach, die aneinanderklebenden Pfannkuchenstücke, die zum Menü gehören, voneinander zu lösen, doch Henry kommt mir zur Hilfe. Mit den Händen, an denen unter den Nägeln die gute Erde klebt, mit Händen, die vorher die Greifstange der U-Bahn, die Klinke zum Restaurant und die einen oder anderen Dinge gegriffen haben, die ich mir an dieser Stelle nicht vorstellen möchte, greift er nach den Pfannkuchen. Ich bin zum Glück schneller. Schnapp, der Pfannkuchen ist meiner.
Der Rest des Essens verläuft ohne größere Zwischenfälle. Beim letzten Bissen frage ich nach der Rechnung. Das ist hier im Land so Sitte. Zwar habe ich darauf bisher gepfiffen und bin lange sitzengeblieben, um Aufzeichnungen zu machen und die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen, aber auf Dauer strengt mich Henrys Basiswortschatz an. Da will ich mal ganz traditionell sein.
Wieder in der U-Bahn und zwei Stationen vor Henrys Haltestelle bedanke ich mich für die nette Begleitung. „War spitze mit dir. Hat Spaß gemacht.“
Henry schüttelt den Kopf. Nein, nicht der Rede wert. Er wolle mich noch ins Hotel, auf mein Zimmer begleiten.
„Ach was, nicht nötig!“ Ich bin schockiert. „Trotzdem nett von dir. Danke für das freundliche Angebot.“
„Doch, doch“, beteuert Henry. Er wolle mir Gesellschaft leisten. Dies sei meine letzte Nacht in Peking.
„Nicht nötig, Henry. Danke dir. Ich will schlafen gehen.“
Ja, genau, das wisse er. Er wollte auf mich aufpassen, während ich schlafe.
Aufpassen will er. Das wird ja immer schöner. Wie schüttele ich den jetzt ab, ohne dass er sein Gesicht verliert? Ohne dass ihm ein Trauma fürs halbe Leben bleibt? Delikate Angelegenheit. Während ich krampfhaft darüber nachdenke, spricht Henry weiter. Er würde sieben Tage die Woche arbeiten und hätte keine Zeit, mich morgen zum Flughafen zu bringen. Deshalb möchte er die ganze Nacht mit mir zusammen sein. Die ganze Nacht – Nachtigall, ick hör dir trapsen.
Er könne nur schlafen, wenn auch ich schlafen würde, so Henry weiter: Und deshalb wolle er auf mich aufpassen. Damit verlassen wir das Titanic-Niveau und sind bei Rosamunde Pilcher angelangt. Ach was, bei Konsalik. Ist das Verb „aufpassen“ eine nette Umschreibung für „miteinander Sex haben“? Sagt man das so in China? So ganz indirekt? Oder bin ich im falschen Film?
Ohne direkt sein zu wollen, wiederholte ich, dass ich SCHLAFEN wolle. Und komme zu ihm durch. Wenn auch nicht hundertprozentig. Er fragt sicherheitshalber: „Du steigst Andingmen aus, ich beim Yonghegong-Lamatempel?“ Ja, genau … ich Andingmen, du Yonghegong.
Ich bin keine einsame Sextouristin, die sich in China verirrt hat, obwohl sie eigentlich nach Thailand wollte, Pardon: nach Afrika. Und suche kein Mitbringsel, das ich nach Deutschland mitnehmen könne. Erst recht nicht in Form eines Ehemannes mit Dreck unter den Fingernägeln. Außerdem hatte ich gehört, dass man in China erst die Eltern fragen müsse, wenn man jemanden heiraten wolle. Wie stellte er sich das alles vor, so überstürzt?! Darüber sinniere ich, als ich ihn – endlich – los bin.
Am nächsten Morgen, als ich um 12 Uhr mein Handy einschalte, erreicht mich eine SMS von Henry. „You are my best friend.“
Seltsam sind sie, die Chinesen.
Hier gehts zu weiteren China-Satiren:
Schweinegrippe
Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie?
Ein Schlüsselerlebnis
Man-wah und ruff uff’n Tisch
Oder doch lieber etwas ernster?
„Wie im Paradies“: Herr Müller in China
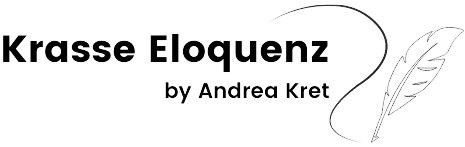



Pingback: „Wie im Paradies“: Herr Müller in China – Krasse Eloquenz
Pingback: Ein Schlüsselerlebnis – Krasse Eloquenz
Pingback: Schweinegrippe – Krasse Eloquenz
Pingback: Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie? – Krasse Eloquenz
Pingback: Man-wah und ruff uff’n Tisch – Krasse Eloquenz
Pingback: Pipi in Paris – Krasse Eloquenz