Volker Müller lebt seit fast 40 Jahren in China. In diesem Gespräch erzählt er nicht nur, was ihn dorthin gezogen hat und warum er auf jeden Fall bleiben will, sondern auch, wie er die Sprache gelernt hat. Er verrät zudem, warum man in Chongqing ein dreidimensionales Ortsgefühl braucht und warum manche Chinesen durchaus die für sie winzige Stadt Mainz kennen.
Wie kommt es, dass Sie in China wohnen, Herr Müller?
Ich bin Jahrgang 59 und bin in den 70er Jahren zur Schule gegangen. Damals waren wir alle linksradikal und gleichzeitig China- und Mao-begeistert. Hinzu kam, dass es in meiner Schule eine Besonderheit gab: Die besten Schüler wurden motiviert, eine Jahresarbeit zu schreiben, freiwillig und unbenotet – und ich gehörte zu diesen Schülern.
In zwei Fächern war ich sehr gut: Mathe und Sozialwissenschaften, wo zu der Zeit gerade ein Kurs zu China lief. Deshalb hatte ich mich entschieden, meine Jahresarbeit über China zu schreiben. So hielt ich mich tagelang in der sinologischen Bibliothek in Göttingen auf, verschlang alles, was es zu dem Land zu lesen gab, und schrieb die dickste Jahresarbeit, die es bis dahin an diesem Gymnasium gegeben hatte.
Wie viele Seiten waren es?
Über hundert, alles auf Schreibmaschine getippt.
Danach hat sich meine Chinabegeisterung eine Zeitlang gelegt; ich habe Elektrotechnik studiert und bekam 1984 mein Diplom überreicht. 1986 kam meine erste Chinareise, die total verrückt war: einmal quer von Hongkong bis nach Xinjiang im Nordwesten Chinas. Sieben Wochen war ich unterwegs – und war fasziniert von dem riesigen Land.
Nach meinem Studium arbeitete ich in einem spezialisierten Feld, das sich OCR nennt, also Optical Character Recognition. In dem Bereich geht es darum, dass man mit Hilfe von Computer und Kamera oder Scanner menschliches Sehen simulieren und Zeichen auf Papier einlesen kann.
Ich hatte überlegt, ob man meine spezielle Fachrichtung und mein Chinainteresse irgendwie zusammenbringen könnte. Auf internationalen Konferenzen hatte ich geschaut, wer aus China in meiner Fachrichtung schon publiziert hat. Und hier hatte ich wirklich Glück: Der Dekan der Informatikfakultät der Universität Chongqing in Südwestchina hatte ich Deutschland promoviert. Er vermittelte mir einen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich OCR. Im Herbst 1987 habe ich in Chongqing angefangen – das war zu der Zeit noch ungewöhnlich für jemanden aus Europa.
Wie war es, auf einmal in China zu leben? Waren Sie erstaunt? Hatten Sie einen Kulturschock?
Ich war begeistert. Es war eine wunderschöne Uni mit subtropischer Vegetation, an einem großen Fluss gelegen. Die Studentenmensa war vom Bau her sehr einfach, das Essen aber himmlisch. Es herrschte eine tolles Gemeinschaftsgefühl an der Uni. Das einzige Problem war, dass die Wenigsten halbwegs gutes Englisch sprachen.
Ich hatte eine Antrittsvorlesung auf Englisch gehalten; nach einer Stunde waren die meisten Zuhörer eingeschlafen. Das lag nicht daran, dass ich furchtbar schlecht vorlas, sondern weil die Zuhörer kein Englisch verstanden.
Von da an habe ich mich jeden Abend an den Schreibtisch gesetzt und intensiv Chinesisch gebüffelt.
Wie würden Sie den Prozess rückblickend beschreiben? Ist es schwer, Chinesisch zu lernen? Welche Hürden kamen auf Sie als Europäer zu?
Die Sprache hat keinerlei Ähnlichkeit mit einer europäischen Sprache. Im Grunde musste ich alles neu lernen. Das Schwierige war, dass es damals kein Internet gab und kaum Lehrmaterialien. Hinzu kam, dass sogar Professoren ihre Vorlesungen im Sichuan-Dialekt hielten. Kaum jemand sprach Hochchinesisch. Das, was man im Fernsehen und Radio hörte, und das, was auf der Straße gesprochen wurde, waren im Prinzip zwei verschiedene Sprachen. Es war wirklich eine große Herausforderung.
Sie hatten im Vorfeld erzählt, dass Sie anders lernen als die meisten. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
In fast allen Sprachen stehen Zeichen für die Aussprache und nicht für die Bedeutung. Im Chinesischen ist das anders. Zum Beispiel gibt es eine Reihe Zeichen, wie die für Sonne (日) oder für Berg (山), bei denen man die Bedeutung noch nachempfinden kann.
Wegen des Bildes?
Genau. Das ist der Vorteil beim Chinesischen. Egal, wie es ausgesprochen wird: Das Zeichen ist immer gleich.
In jedem Dialekt?
Ja, in verschiedenen Dialekten wird ein Zeichen allerdings völlig unterschiedlich ausgesprochen. Selbst über Sprachgrenzen hinweg: Im Vietnamesischen wurden früher chinesische Zeichen verwendet – inzwischen gab es dort eine Zeichenreform. Im Japanischen und Koreanischen kommen viele Zeichen aus dem Chinesischen. Die Aussprache ist allerdings anders.

Das heißt, wenn Sie nach Korea reisen, haben Sie teilweise eine Vorstellung davon, was auf den Straßenschildern steht?
Die koreanische Sprache verwendet hauptsächlich ihre eigene Schrift, aber in Ortsnamen treten chinesische Zeichen auf. Noch stärker im Japanischen. Manchmal bekomme ich eine japanische Gebrauchsanweisung zwischen die Finger und kann ein bisschen raten, was dort gemeint ist – obwohl ich keinerlei Vorstellung habe, wie es ausgesprochen wird.
Es gibt eine große Anzahl chinesischer Zeichen. Der Basissatz, mit dem man eine chinesische Zeitung lesen könnte, wären in etwa 3.500 Zeichen. Das umfangreichste Wörterbuch enthält 106.200 verschiedene Zeichen, von denen die meisten allerdings heute nicht mehr gebraucht werden; die heutigen Computersysteme können zirka 21 Tausend verarbeiten.
Viele Europäer tun sich mit dem Lernen der Zeichen schwer. Im Deutschen hat man in etwa 30 – die lernt ein Kind innerhalb von Tagen. Wenn man dann – ob als Kind oder Einwanderer – 3.500 Zeichen lernen muss, dauert das seine Zeit.
Viele Deutsche, die Chinesisch lernen, trennen das. Sie beschäftigen sich erst mit der Aussprache und trainieren Sprechen und Hören – und dann erst mit den Zeichen. Ich selbst bin kein Sprachtalent, sondern eher mathematisch und graphisch orientiert und kenne mich auf dem Gebiet der Zeichenerkennung besonders gut aus. Deshalb hatte ich schon sehr früh eine Faszination für chinesische Zeichen entwickelt und sie von Anfang an mitgelernt. Mit dem Verstehen habe ich mich lange schwergetan – eben weil ich die Sprache in einem Dialektgebiet gelernt habe. Durch den frühen Kontakt mit den Zeichen hatte ich aber einen entscheidenden Vorteil, denn man lernt oft durch das Zeitunglesen, durch den täglichen visuellen Eindruck auf der Straße.
Viele chinesische Fernsehsendungen werden mit Untertiteln ausgestrahlt – weil die Sprache so viele Dialekte hat. Wenn man etwas nicht versteht, kann man sich die Zeichen anschauen; das hilft dem Lernenden.
Ja, das ist sicher ähnlich, wie wenn man Filme in der Originalsprache mit Untertiteln gucken würde.
Kommen wir nochmal zurück auf Chongqing: Wie ist die Stadt? Auch wenn man sie in Europa nicht unbedingt kennt, ist sie vermutlich sehr groß.
Deshalb sage ich immer: Es gibt eine Asymmetrie in der Landeskunde zwischen Deutschland und China. Die meisten Chinesen kennen sich sehr gut in Deutschland aus.
Tatsächlich?
Ein Kollege von mir kannte Mainz. Als ich ihn fragte, woher, sagte er nur: „Mainz 05.“ Das ist eine Fußballmannschaft; deutscher Fußball wird jede Woche im chinesischen Fernsehen übertragen Er kannte diese winzige Stadt – Chongqing hat im Gegensatz dazu 32 Millionen Einwohner und in etwa die Fläche von Österreich. Es ist ein Riesengebiet mit Bergen und Bereichen, in denen man nicht das Gefühl hat, in einer Großstadt zu sein.
Aber in der Stadt selbst gibt es schon die berühmten Wolkenkratzer?
Ja, wobei die Stadt eine ganz eigene Lokalkultur hat. Sie ist auf Bergen gebaut – keine Riesenberge, aber schon einige hundert Meter hoch.

Kennen Sie China?
Ich war in Peking und in Shanghai. Gibt es da Unterschiede im Vergleich zu Chongqing?
Beijing ist wie ein Schachbrett aufgebaut, mit Nord-Süd- und Ost-West-Achsen. So etwas geht in Chongqing nicht. Die Stadt schmiegt sich an die Topografie an. Um sich dort zu orientieren, braucht man ein dreidimensionales Ortsgefühl. Es gibt architektonische Kuriositäten: Man geht beispielsweise im Erdgeschoss in ein Gebäude, fährt bis zum Dachgeschoss in der 20. oder 30. Etage, wo es eine Brücke gibt, über die man das Gebäude wieder verlassen kann – und damit auch auf einer anderen höhergelegenen Ebene steht. Das muss man gesehen haben.
Ich möchte noch einmal auf das chinesische Essen zurückkommen, das Sie erwähnt haben: Können die Chinesen das mit dem Kochen besser als Deutsche?
Ich denke ja. Essen ist ein wesentlicher Bestandteil der chinesischen Kultur. In Chongqing isst man sehr scharf, aber auch sehr vielfältig – die Speisen haben einen ganz eigenen Geschmack. Viele Chinesen, die nach Deutschland gehen, tun sich schwer mit dem Essen. Man sagt hier, dass jeder Chinese, der nach Deutschland kommt und nicht kochen kann, es spätestens hier lernt.
(Ich lache.)
Aber ich habe nie gehört, dass sich Deutsche mit dem chinesischen Essen schwertun. Jeder findet hier seine Geschmacksrichtung. Für mich ist es wie im Paradies.
Sie haben eben von den Chinesen gesprochen, die Deutschland so gut kennen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Deutschland ist sehr ich-bezogen oder nationalbezogen. Man lernt zwar internationale Geschichte und erfährt etwas über die internationale Kultur, aber doch nur sehr begrenzt. Eher bleibt man an der Oberfläche. Es besteht auch wenig Interesse daran, die chinesische Kultur und Geschichte ernsthaft zu vermitteln. In dieser Hinsicht ist Deutschland nicht besonders offen.
Während auf der anderen Seite China den Ruf hatte, gegenüber dem Westen verschlossen zu sein, sind Goethe oder Kant Teil des chinesischen Lehrplans. Jeder hiesige Gymnasiast hat zumindest schon mal davon gehört. Chinesen sind auch sehr interessiert daran, die Welt zu bereisen, um andere Kulturen kennenzulernen.
Zum Ende der Kaiserzeit war China sehr isoliert. Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts standen Politiker im Vordergrund, die in ihrer Jugend nach Frankreich oder generell Europa geschickt wurden, um vom Westen zu lernen. Sie sollten schauen, wie ein moderner Staat funktioniert, wie die westliche Technologie. Diese Generation war der Überzeugung, dass China von Europa lernen müsse, und hat diese Überzeugung in ihr Heimatland getragen. Die Zukunft Chinas liegt darin, dieses Wissen nutzbar zu machen.
Das sehe ich bis heute. Natürlich ist China selbstbewusster geworden, kann eigene Erfindungen, beispielsweise im Bereich künstliche Intelligenz, vorweisen. Auch im Eisenbahnwesen in China ist Spitzenklasse.
Und trotzdem ist man hier interessiert daran zu schauen, was auf der Welt passiert. Ich selbst bin im Bereich der Gesundheitsreformen tätig. Wenn man sich das chinesische Sozialversicherungssystem anschaut oder Abrechnungsverfahren in Krankenhäusern, merkt man, dass die Chinesen sich damit beschäftigt haben, was in Deutschland passiert. Es ist offensichtlich, dass Deutschland als Vorbild diente.
Auf der einen Seite würde ich sagen, China ist gesund patriotisch. Das Land ist stolz auf die eigenen Errungenschaften, die schier unglaublich sind. Man will sich vom Westen nicht reinreden lassen, wie der Staat und die eigene Politik zu gestalten seien.
Andersherum ist man aber immer bereit, von anderen zu lernen. Bis heute steht es hoch im Kurs, für eine Ausbildung oder ein Studium nach Deutschland oder in andere Länder zu gehen.
Auch wenn mein Blog nicht politisch ist, hätte ich doch eine einigermaßen politische Frage: Wie lebt es sich mit dem Sozialpunktesystem in China?
Natürlich kann ich das Unbehagen vieler Deutscher irgendwo verstehen, weil direkte Informationen aus China schwer zu bekommen sind und man auf Medien angewiesen ist. Diese Informationen sind allerdings unvollständig.
Dieses Sozialkreditsystem ist für Unternehmen eingeführt worden. Jedes Unternehmen ist in einer Datenbank registriert, anhand derer man seine soziale Glaubwürdigkeit abfragen kann. In die Bewertung fließt einiges hinein: ob die Firma sich beispielsweise an Arbeits- oder Umweltgesetze hält. Es geht unter anderem auch um die Vertragserfüllung. Insgesamt wurde das System positiv aufgenommen, auch von der internationalen Industrie. Bei einem Land, das so groß ist wie China, hat man damit ein gewisses Werkzeug an der Hand, um zu erkennen, ob ein neuer Geschäftspartner glaubwürdig ist und sich an Verträge hält.
Zu Anfang wollte man dies auch auf Privatpersonen ausdehnen. Das war zum Teil aber nicht realisierbar, weil man versucht hatte, moralische oder rechtliche Aspekte zu vermischen. Also meinetwegen: Wer regelmäßig seine Eltern besucht oder ehrenamtlich tätig ist, bekommt Pluspunkte, wer bei Rot über die Straße geht, kriegt Abzüge.
Etwas, was für China typisch ist und hier auch geht, weil das Land so groß ist, ist der Ansatz, dass Gesetzesvorhaben erst einmal in kleinem Rahmen ausprobiert werden, was auch in diesem Fall geschah. Seit mehr als drei Jahren habe ich nun von dem Sozialpunktesystem für Privatpersonen nichts mehr gehört – das mag natürlich auch mit Covid zusammenhängen. Meine private Einschätzung ist, dass die Angelegenheit vom Tisch ist.
„Jeder, der politisch unliebsame Statements abgibt oder seine Eltern nicht besucht, wird negativ bewertet“ – das ist durch die Presse gegangen und ist bei vielen hängengeblieben. Aber dass das bei Privatpersonen – außer in einigen lokalen Pilotprojekten – nie realisiert wurde, das weiß wohl niemand in Deutschland. Und vielleicht gibt es auch kein Interesse daran, das klarzustellen.
Springen wir einmal zur Literatur: Sie haben gesagt, dass der Name Goethe einem durchschnittlichen chinesischen Abiturienten etwas sagt. Hier in Europa ist es jedoch so, dass wir kaum chinesische Schriftsteller kennen. Daher meine Frage: Was aus der chinesischen Literatur sollte ein Europäer gelesen haben? Welches literarische Werk können Sie empfehlen?
Als ich 2009 in China war, hatte ich mir dort zum Beispiel das Buch „Shanghai Baby“ einer chinesischen Autorin gekauft. Ich würde gern etwas von dort lesen, weiß aber nicht, was. Hätten Sie einen Tipp für mich?
Ein großes Problem ist, dass die Anzahl der Übersetzungen sehr begrenzt ist.
Sonst gern eine englische Übersetzung.
Da wäre zum Beispiel Mo Yan – selbst den kennt wahrscheinlich niemand in Deutschland. Er hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Es ist zwar moderne Literatur, aber nicht wirklich zeitgenössisch. Der Autor schreibt viel über seine Kindheit auf dem Dorf, über das Aufwachsen in Zeiten des Umbruchs. Wenn man das China der letzten Jahre verstehen will, ist das schon interessant.
Der bekannteste klassische Schriftsteller ist Lu Xun. Er lebte vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die 50er Jahre und beschrieb die Jahre des Wandels. Lu Xun ist die klassische Gestalt der chinesischen Literatur.
Sie sind nach eigener Aussage Tibet-Enthusiast. Was mögen Sie an der Region?
Sie haut einen um; das muss man einfach so sagen. Wer vor einer 3000 Meter hohen Wand steht – dem Mount Everest – und nicht spirituell ist, der wird es spätestens dann. Das ist einer der großen Momente im Leben.
Sie haben dort auch gestanden?
Ja, genau.
Noch ein anderes Erlebnis: Im unterentwickelten westlichen Tibet, das erst in den letzten Jahren touristisch erschlossen wurde, gibt es einen heiligen Berg: den Mount Kailash. Im tibetischen Buddhismus besteigt man Berge jedoch nicht, man umrundet sie. Eine Umrundung dauert zwei bis drei Tage. Der höchste Pass liegt dabei bei 5600 Metern.
Als ich am Mount Kailash in 4000 Meter Höhe ankam, fühlte ich mich nach der tagelangen Anfahrt nicht ganz so toll. Doch dann, bei der Umrundung, hatte ich auf einmal das Gefühl, als sei ich wieder jung; ich war voller Energie, hätte loslaufen können.
Mich beschäftigte die Frage: Was ist das?! Buddhisten, Hinduisten und andere Religionen zieht es zu diesem Berg. Warum machen die das? Ist das Zufall? Und ich komme dahin als Ingenieur, als Verstandesmensch und fühle mich bei der Umrundung wie neugeboren. Das habe ich nur in Tibet so erlebt und sonst nirgendwo auf der Welt.

Ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, man würde den Berg nicht besteigen. Das habe ich so noch nie gehört, nur beim Uluru in Australien. Den besteigen die indigenen Völker auch nicht. Wobei das schon einleuchtet: Westliche Menschen bezwingen ja in einem gewissen Sinn den Berg, indem sie bis an seine Spitze klettern. Was ist der Hintergrund, warum man den Mount Kailash nicht heraufgeht?
Der tibetische Buddhismus hat sehr viel von noch älteren Religionen aus dem tibetischen Hochland übernommen In der indischen Kultur gibt es das Begriffspaar Lingam und Yoni. Das sind religiöse, aber auch sehr weltliche Symbole, die das männliche und das weibliche Geschlecht symbolisieren.
Genau, das kennt man aus dem Tantra.
Wenn man das auf geografische Dimensionen überträgt, dann symbolisiert ein Berg das männliche Geschlecht und ein See das weibliche. Im tibetischen Buddhismus bilden ein See und ein Berg immer eine heilige Einheit. Ein Berg ist in Tibet eine Gott und ein See eine Göttin.– wohingegen Berge in der griechischen Mythologie „nur“ Sitz der Götter waren.
Der Kailash ist einer von drei heiligen Bergen – zwei in China, einer in Nepal –, die auf keinen Fall bestiegen werden dürfen. Reinhold Messner hatte mal überlegt, wie er den Kailash angehen könne, aber da haben die Menschen vor Ort ihm gesagt, das sei mit ihrer Religion nicht kompatibel. Am Ende nahm er Abstand davon.
Sie sagten, Sie übersetzen aus dem Chinesischen. Was übersetzen Sie?
Bisher liegt mein Schwerpunkt auf Reiseliteratur. Das Buch „Durchs Wilde Tibet“ der Chongqinger Autorin Hong Chen ist 2021 im Drachenhaus-Verlag erschienen. Ein zweites Buch der gleichen Autorin über Reisen in Nepal ist fertig übersetzt und soll in Kürze erscheinen.
Als drittes Buch werde ich sehr bald eins vom Hobbyhistoriker Liu Yang übersetzen. Dort geht es um die zentralen Achsen Beijings – präzise entlang der Himmelsrichtungen ausgerichtet –, an denen sich die kaiserlichen Bauten und die Stadtplanung von Beijing bis zum heutigen Tag orientieren. Diese Achsen sollen nächstes Jahr ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden. Hierzu hatte Liu Yang einen schönen Bildband erstellt – das ist mein nächstes Projekt.
Welche Hürden muss jemand, der vom Chinesischen ins Deutsche übersetzt, nehmen, die ich mir mit meinen Kenntnissen der indoeuropäischen Sprachen nicht vorstellen kann? Welche Probleme tauchen immer wieder auf?
Probleme tauchen auf allen Ebenen auf. Chinesischen Autoren bzw. Leser haben Hintergrundwissen, das ein Deutscher gar nicht haben kann. Oft beziehen sie sich in ihren Werken auf bestimmte geschichtliche und kulturelle Erscheinungen. Beispielsweise wurden einmal in einem Fall Liedzeilen eines sehr bekannten chinesischen Popsängers zitiert. Wie behandelt man so etwas in der Übersetzung? Entweder man fügt einen erklärenden Text hinzu oder man versucht, es in irgendeiner Form umzudichten, man arbeitet mit längeren Fußnoten oder lässt sie ganz weg. Hier kann man nicht einfach eins zu eins übersetzen, weil der Text sonst für Leser ohne kulturelles Hintergrundwissen unverständlich bleibt.
Ich glaube, im Chinesischen gibt es auch viel mehr Redewendungen als im Deutschen. Viele davon lassen sich sprachlich gar nicht erklären, sondern stützen sich auf historische Begebenheiten, zum Beispiel welche aus der Zeit des Konfuzianismus. Wer in China zur Schule gegangen ist, kennt diese Redewendungen. Es gibt oft bloß keine Möglichkeit, sie in wenigen Worten wiederzugeben.
Wenn es kein Sachbuch ist, muss es ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Übersetzer und der Autorin geben. Ich hatte das in einem Fall so gemacht, dass ich am Anfang eine Rohübersetzung angefertigt habe und es anschließend in eigenen Worten formulierte. Zum Teil bin ich so recht stark vom Original abgewichen.
Kommen wir noch ein letztes Mal auf Chongqing zurück: In einem Ihrer Artikel habe ich gelesen, dass dort viel gefeiert wird. Was wird denn dort gefeiert? Und vor allem wie?
China ist 27-mal größer als Deutschland. Das heißt auch, dass unterschiedliche Orte einen eigenen Menschenschlag und eine eigene Lokalkultur haben. Beijing und Chongqing sind ein bisschen so wie Hamburg und München. Es ist zwar ein Land, aber darin finden sich unterschiedliche Lokalkulturen. Die Menschen in Chongqing sind fröhlich und müssen nicht unbedingt einen Anlass zum Feiern haben. Nachts werden Tische auf die Straße gestellt, man isst gemeinsam den lokalen Feuertopf, redet, singt. Meist geht das ohne Alkohol vonstatten – das finde ich toll. Es gibt in China auch Trinkexzesse; das ist aber eine ganz andere Geschichte. Auf der Straße steht jedoch das gemeinsame Essen, der schöne Abend im Vordergrund.
Was aus Deutschland vermissen Sie in China?
Wenig. Oder doch eine Sache: Wir sind hier in Beijing auf dem 40. Breitengrad und Chongqing liegt noch südlicher. Hier gibt es – anders als in Norddeutschland – nicht diese langen Abende, an denen es nachts um 23 Uhr noch hell ist. Das fehlt mir manchmal

Und was vermissen Sie überhaupt nicht? Bei welchen Dingen sind Sie froh, dass Sie sie hinter sich gelassen haben?
Insgesamt finde ich die Menschen in China ein Stück weit freundlicher. Offensichtlich erkennbaren Ausländern gegenüber ist man sehr, sehr zuvorkommend. Sie haben eine Art Idiotenstatus und dürfen auch mal etwas falsch machen, ohne dass ihnen das übel genommen wird. Das finde ich sehr schön.
Ich habe immer noch mit Deutschen zu tun und spüre von ihrer Seite immer wieder eine gewisse Überheblichkeit oder Ruppigkeit beim Umgang mit anderen Menschen. Da finde ich es in China menschlich angenehmer. Auch wenn man in sachlichen Fragen Meinungsverschiedenheiten hat, wird das nicht persönlich genommen.
Warum sollte man Ihrer Ansicht nach als Deutsche oder Europäerin Chinesisch lernen?
Für die meisten wäre die Motivation eine wirtschaftliche – so haben sie die Möglichkeit zum Kontakt nach China. Viele Deutsche, die hierherkommen, lernen kein Chinesisch, und das finde ich schade. Damit vergeben sie sich auch wirtschaftliche Chancen. Meine Erfahrung in China – ob ich mit Regierungsvertretern rede oder mit Geschäftspartnern und Kollegen: Wenn man sich des Englischen bedient oder einen Dolmetscher hinzuzieht, schafft das immer eine gewisse Fremdheit. Sobald man Chinesisch spricht, ist das Eis gebrochen. Es wird schnell vertrauter, die Scheu voreinander verschwindet. Man unterhält sich viel lockerer und bekommt auch Zugang zu Menschen, zu denen man sonst keinen Kontakt hätte. Manche Chinesen sehen es als Gesichtsverlust an, wenn sie kein Englisch können, und vermeiden dann lieber Treffen, in denen Englisch gesprochen wird.
Meine Managementphilosophie ist: Man sollte mit dem sprechen können, der an der Maschine steht. Wenn man zu diesem Menschen keinen direkten Zugang hat, kann man kein guter Manager sein.
Der Freundeskreis ist auch ein ganz anderer, wenn man Chinesisch spricht.
Zudem ist China einer der größten Buchmärkte der Welt. Nur ein winziger Teil der Bücher wird ins Englische oder Deutsche übersetzt. Aber gerade durch Bücher bekommt man einen ganz anderen Zugang zum Denken und zur Philosophie Chinas.
Durch Chinesisch eröffnet sich einem eine ganz andere Welt, nämlich die von 1,4 Milliarden Menschen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müller, das war wirklich interessant.
Und wie erleben Chinesen Deutschland? Lies hierzu das Interview mit Yiming.
Oder interessieren dich Auswanderungsgeschichten? Heiko ist nach Ungarn ausgewandert – mehr dazu im Interview „Auswandern – nach Ungarn???“.
Vielleicht hast du es aber eher mit den „exotischen“ Sprachen. Dann lies gern den Text „Man muss jede Sprache anders lernen“.
Und hier geht es zu meinen China-Satiren:
Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie?
Ein Schlüsselerlebnis
Schweinegrippe
Pekingente, pikant
Man-wah und ruff uff’n Tisch
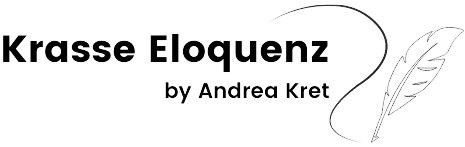


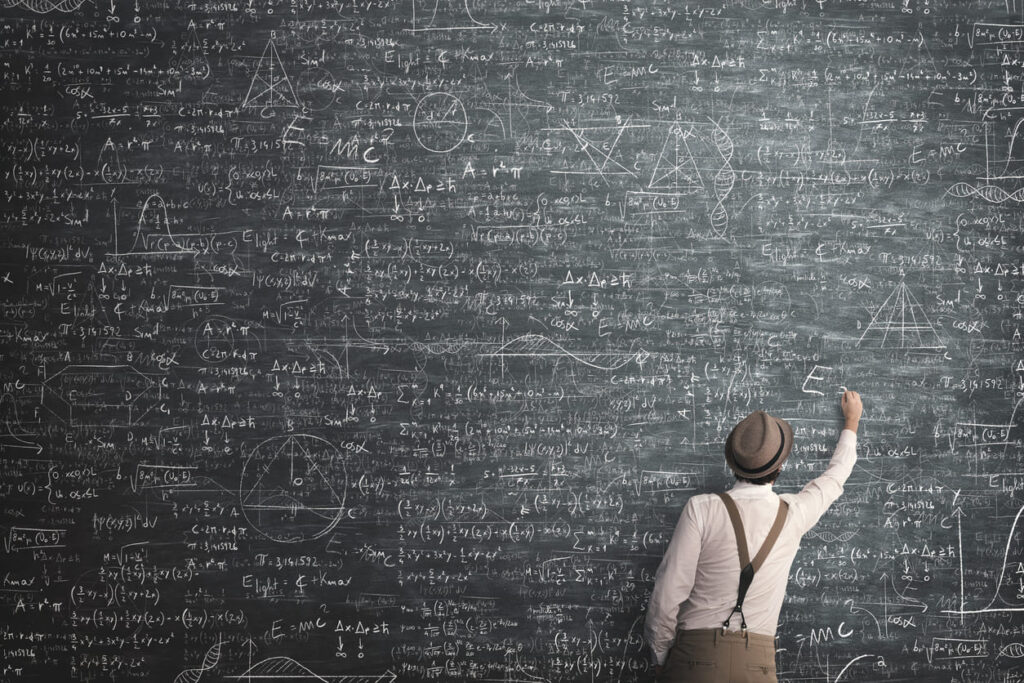
Pingback: Ein Schlüsselerlebnis – Krasse Eloquenz
Pingback: „Man muss jede Sprache anders lernen“ – Krasse Eloquenz
Pingback: „Ewige Diskussionen sind einfach nur anstrengend!“ – Krasse Eloquenz
Pingback: Man-wah und ruff uff’n Tisch – Krasse Eloquenz
Pingback: Schweinegrippe – Krasse Eloquenz
Pingback: Pekingente, pikant – Krasse Eloquenz
Pingback: Maßgeschneidert? Bloß nicht! – Eine etwas andere Jobsuche – Krasse Eloquenz
Pingback: IT und Sprache? – Nein. Doch. Ahh! - Krasse Eloquenz