Dies hier wird keine gute Story. Dazu sind die Skandinavier zu normal. Brausen nicht aus unerklärlichen Gründen auf, wollen deine Haare nicht anfassen, sind halbwegs berechenbar, wie die Hamburger, dazu haben sie zusätzlich zwei Gänge heruntergeschaltet.
Ich machte mich mit meiner Klapperkiste, die ich kurz vorher für 650 Euro erstanden hatte, auf zu einem Roadtrip durch Schweden und Norwegen. Strenggenommen auch durch Dänemark, wobei mir dieser Staat in jungen Jahren ein kleines Trauma verpasst hat. Damals waren wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Kopenhagen aufgebrochen, nur um dort festzustellen, dass wir uns das Land nicht leisten konnten. Während man in Norddeutschland auf dem Rummel für jedes Fahrgeschäft bezahlte, beim Vergnügungspark nur am Eingang, trieben die Dänen bereits das auf die Spitze und wollten sowohl für den Eintritt wie auch für jedes einzelne Fahrgeschäft Bares sehen.
Auch die Hotdogs waren mir und meinem Freund, von einem Studentenbudget lebend, zu teuer. Wir entschieden uns daher für einen „Krassen“. Der war so krass, dass es nicht einmal für ein Würstchen reichte.
Nein, diesmal würde ich von Dänemark nur die Autobahn sehen, auch wenn mich beim Vorbeifahren am Fuße einer Brücke eine Postkartenidylle lockte: rot-weißer Leuchtturm, Meer, Sand und Schilfgras. Vielleicht würde ich auf dem Rückweg doch hier Halt machen, schließlich hatte ich nichts gebucht, war frei wie ein Vogel.
Natürlich hatte diese Freiheit ihren Preis. Voller Sorge war ich aufgebrochen: Würde meine Geldbörse den norwegischen Hang zu Luxuspreisen überstehen? Konnte ich bar zahlen, so ganz ohne Kreditkarte, in zwei Ländern, in denen man schon lange über die Abschaffung des Bargelds nachdachte? Konnte ich überhaupt Geld wechseln? Wo käme ich unter? Wo würde ich in Malmö, Göteborg, Oslo, Bergen und Stockholm parken? Was war mit dem Dauerregen in Norwegen? Und vor allem: Würde mein Wagen die dreitausend Kilometer durchhalten?
Malmö als Auftakt war schon mal schön, auch wenn ich mein Auto eine halbe Gehstunde vom Hotel parken musste, weil ich durch das Parksystem mit den verschiedenen Farben nicht durchblickte und nur ungern Gefahr lief, abgeschleppt zu werden. Meine Beine waren nach dem Tag Lauferei durch die charmant-unaufgeregte Stadt im Eimer, weil ich auch nicht genau verstanden hatte, wo man hier eine Fahrkarte kaufen konnte. Ich stand morgens zum Zwangsfrühstück auf, das ich in anderen Hotels als Langschläferin üblicherweise ausfallen ließ. Hier galt es, so viel in sich hineinzustopfen, wie nur ging, um anschließend möglichst lange ohne Nahrungsaufnahme durchzuhalten.
Auf dem Weg nach Göteborg informierte mich mein Navi darüber, dass die Karte 500 Monate alt sei, und um das zu demonstrieren, fuhr ich laut Display über eine grüne Wiese, verwirrte das arme Gerät, denn vor 500 Monaten war hier noch keine Autobahn gewesen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich dachte, die Karte zu Hause aktualisiert zu haben.
In der Stadt begannen die ersten Komplikationen. Das Hostel, das ich am Abend zuvor herausgesucht hatte, verweigerte mir mein ersehntes Einzelzimmer und wollte mir wegen Überbelegung nur ein Großraumschlafsaal andrehen. Ich stieg wieder ins Auto, fuhr weiter und hielt an einem Hotel an der Wasserseite. Nicht sehr lange hielt ich dort, die hohen Preise schwemmten mich gleich weiter.
Was nun? Ich suchte auf dem Navi nach den umliegenden „points of interest“ und wählte eine Pension mit einem möglichst langweiligen Namen. Die war so ausgebucht, dass man mich gar nicht erst hineinließ, sondern gleich an der Gegensprechanlage abfertigte. Bei der nächsten Pension hatte ich Glück, durfte hinein, wurde akzeptiert und zahlte gar nicht mal so viel. Nur meinen Wagen konnte ich nicht vor der Tür stehen lassen. Aber ganz in der Nähe, nur eine halbe Stunde Fußweg entfernt, sei ein Stadion, in dem es ausreichend Parkraum gab, wenn man nur genug Münzen hineinwarf.
Wie es der Zufall so wollte, landete ich auf dem Weg dorthin mit meinem Wagen kurzzeitig auf dem Bürgersteig – ich weiß selbst nicht, wie ich das hingekriegt hatte. Ich fuhr wieder herunter, fand mich im Gegenverkehr wieder und lernte so die Besonnenheit der Skandinavier doch noch zu schätzen.
Oslo wollte ich eigentlich links liegenlassen, denn die YouTube-Videos zu dem Thema versprachen nichts Aufregendes; angepriesen wurde lediglich der Lokus in der Marmoroper, die in den Filmchen auch keinen besonders imposanten Eindruck machte.
Rückblickend kann ich bestätigen: Das Klo in der Oper ist eine Wucht. Es kackt sich gleich ganz anders, umgeben von schweren Goldtüren. Aber auch der Rest des Gebäudes, der Marmor, in dem sich die Sonne spiegelte und mich blendete, ließ mich den Zwischenstopp in der Stadt dennoch nicht bereuen. Beim prächtigsten Sonnenschein war jeder, ja wirklich jeder Osloer draußen, saß auf den Bänken vor den Cafés, mit dem Rücken zum Lokal, und blickte auf die Straße. Ich hätte mich gern dazugesetzt, allein mir fehlte das nötige Kleingeld – die Reise war ja erst an ihrem Anfang. So stopfte ich am Abend Stapelchips in mich hinein und sackte gesättigt ins Bett.
Noch konnte ich umkehren und die Konfrontation mit den norwegischen Bergen vermeiden. Die Frage war nicht nur, ob der Wagen es raufschaffen würde, sondern auch, wie er wieder hinunterkommen sollte – ob die Bremsen das auf Dauer durchhielten. Und die Stadt am westlichen Rand von Norwegen, die mein Ziel war, hieß vermutlich nicht durch Zufall Bergen.
Dann der Dauerregen, der weltweit Berühmtheit erlangt hatte. Ich wusste nicht, ob mein mentales Nervenkostüm stark genug dafür war.

Irgendwie schaffte ich es, aus dem dichten Osloer Stadtverkehr herauszufinden und fand mich in einer anderen Welt wieder: dunkle Berge und Felsen am Rande der Straße, immer wieder ein See. An einem Rastplatz kaufte ich mir einen kleinen Latte macchiato und ein Krabbenbrötchen für 13 Euro, eine Investition, die sich beim Anblick der Berge bereits amortisiert hatte.
Ich bestieg wieder den Wagen, machte im mp3-Player ein Minimal-Trance-Stück rein, das eine Stunde brauchte, sich zu entwickeln, und fuhr weiter über die Serpentinen mit 80 km/h. Mehr war nicht erlaubt. Verwirrend war nur, dass man nicht auf jedem Streckenabschnitt 80 fahren durfte. Manchmal waren es 60 Kilometer, dann die vollen 80, dann wieder etwas dazwischen. Konnte ich mir alles nicht merken. Fuhr also mit stetigen 60 km/h durch einen Sieben-Kilometer-Tunnel, hielt anschließend in einer Parkbucht und wunderte mich fast gar nicht, dass ich von den ruhigen Norwegern ausgehupt wurde. Selbst noch der letzte war so aufgebracht, dass er mir einen Vogel zeigte.
Ja was?! Weißt du, Depp, nicht, dass hier Geschwindigkeitsübertretungen aufs Schärfste bestraft werden?! Ich kann doch nicht 80 fahren, wenn ich nicht sicher bin, dass das auch gerade wirklich gilt. So was aber auch …
Die vielen Tunnel waren eine Plage. Beim Reinfahren Licht an, am Ende wieder aus. Scheibenwischer an, weil es draußen regnete. Dann wieder schnell ausmachen, sobald sie sich mit Widerstand über die Frontscheibe schoben. Und die Lüftung? Lieber anlassen und an Abgasen ersticken? Oder ausmachen und eine beschlagene Scheibe riskieren? Schwierige Entscheidung. Manche Tunnel waren unbeleuchtet wie eine Geisterbahn und ich hatte Probleme, mich beim Hineinfahren zu orientieren, andere beherbergten tief in ihrem Inneren einen Kreisverkehr.
Die spinnen, die Norweger.
Die Tunnel waren passé; es ging hinauf auf den Berg. Mein Wagen hielt sich tapfer. Am Rande des Weges ein reißender Bach. Schafe hatten sich auf die Straße gefläzt, schliefen in der Sonne. Ich überholte einen Skilangläufer auf Sommerskiern. Die Gegend war fast menschenleer, kaum Verkehr, nur hier und da eine einsame Hütte. Ringsum Stille und Wälder, die mich anschwiegen. Ich und mein Wagen, wir tauchten ein in die unvergleichliche Natur. Angesichts dieser Berge waren die Probleme dieser Welt egal.
Die Landschaft veränderte sich, auf den Felsen wuchs Moos, stellenweise sah ich Schnee, es wehte ein nordischer Wind. Ein paar Asiaten waren ausgestiegen und ließen sich mit dem Weiß im Hintergrund fotografieren. Schnee im Sommer – das mussten sie unbedingt ihren Freunden daheim zeigen.
Mir wurde mulmig zumute, als ich in eine Straße voller Schlaglöcher einbog und mein Navi schlappmachte, weil es das Berghotel schlichtweg nicht kannte. Je weiter ich fuhr, desto klarer war es, dass dieser Ort auf keiner Karte der Welt existierte. Immerhin funktionierte Google Maps und ich vertraute mich dem Programm an. Das wollte immer weiterfahren, geradewegs über die unebene Straße. Da war ein Schild! Es wies zu meinem Hotel. Dann lange Zeit nichts. Der Wagen stolperte über die Unebenheiten und ich fragte mich, wie ich dem ADAC den Weg hierher beschreiben würde, wenn die Ölwanne einen abbekam. Gut organisiert, wie ich war, hatte ich vor der Fahrt eine Plus-Mitgliedschaft abgeschlossen, mit Rücktransport nach Hamburg.
Es kam kein Schild mehr, die Frau von Google schwieg ebenfalls seit mehreren Minuten. Ich blickte nach hinten auf den Rücksitz, wo meine Bettdecke mitsamt Kissen lag, nur für alle Fälle, und hatte den Eindruck, dass einer dieser Fälle heute eintreten würde, konnte der Situation trotz des weisen Vorausdenkens nichts abgewinnen. Eine Nacht in der nordischen Kühle, auf dem Beifahrersitz eines kleinen Mazdas, schien mir nicht besonders attraktiv.
Ich kam an eine verlassene Mautstation. Die Schranke war oben, doch die Tafel informierte mich darüber, dass ich dennoch einen Obolus zu entrichten hatte – ein Automat stand zu diesem Zweck bereit. Die Station war videoüberwacht. Na prima. Natürlich hatte ich keine Münzen im Portemonnaie, schob meine EC-Karte in den Schlitz, um meinen guten Willen zu demonstrieren; akzeptiert wurde sie trotzdem nicht. Mit dem Gewissen eines Bankräubers passierte ich die Mautstation – und erreichte bei Einbruch der Dunkelheit tatsächlich das luxuriöse Hotel mitten im Nichts, wo man an der Rezeption nur lachte: Die Benutzung der Straße sei für Hotelgäste selbstverständlich kostenlos.
„Haben Sie bezahlt?“, fragte der Rezeptionist auf Deutsch.
Hier hörten die Schwierigkeiten noch lange nicht auf: Zwar war mir ein weiches Bett sicher, der Tank jedoch war zu drei Vierteln leer, obwohl ich mir vorgenommen hatte, ihn nicht unter die Hälfte sinken zu lassen. Bei der Weiterreise traf ich überall nur auf Tankautomaten, an denen man mit Kreditkarte zahlen sollte. Die ich jedoch nicht besaß, so weit reichte meine gute Vorausplanung dann doch nicht.
Ich hatte es geahnt, dass es eine Schnapsidee war, mich in dieses Land ohne Plastikgeld aufzumachen, besann mich auf die Lektion aus dem Fahrschulbuch zum spritsparenden Fahren, dachte darüber nach, ob ich den Berg mit ausgeschaltetem Motor hinunterrollen sollte, bemühte dann aber doch den spritfressenden ersten Gang. Bangte bei jedem Kilometer, den der Wagen fraß. Vielleicht konnte ich einen blonden Norweger dazu überreden, für mich zu tanken und Bargeld von mir anzunehmen? Ich sah sogar eine blonde Lastwagenfahrerin, bloß tankte die Diesel. Selbst die Kühe, die seelenruhig über die Straße spazierten, als ich wieder auf gerader Strecke fuhr, konnten mich nicht aufheitert.
„Sag mal, merkst du nichts mehr? Ich darf hier 80 fahren!“, rief ich einer von ihnen aus dem Fenster zu. Sie setzte ihren Gang über die Fahrbahn fort. Und dann endlich: eine Tankstelle! Man akzeptierte gönnerhafte mein Bargeld und konnte sich keinen Reim darauf machen, warum ich bis über beide Ohren strahlte. Unweit der Tanke eine Raststätte, in der es ordentliche Burger mit Pommes gab. Die Aussicht auf einen Berg und einen Bergsee gab es hier bei jeder Bestellung gratis dazu. Die Welt war wieder in Ordnung.
In Bergen, der „Badewanne Norwegens“, schien die Sonne – langsam konnte ich das Gewese um das schlechte Wetter in Skandinavien nicht verstehen. Weil es so lange hell blieb, hatte ich Zeit, am späten Abend einen Rundgang durch die Stadt zu machen, das obligatorische Foto der bunten Häuserfront zu schießen und mir anschließend in einem Fischimbiss einen Scampispieß und ein Stück Lachs für 25 Euro zu genehmigen. 45 Minuten später – so lange dauerte die Fahrt zu meinem Hotel außerhalb der Stadt – lag ich im Bett, um 140 Euro ärmer. So viel nämlich kostete eine Nacht hier. Hoffentlich würde ich aus dem Land raus sein, solange noch ein bisschen Geld im meinem Portemonnaie übrig war. Hoffentlich würde meinem Wagen dieselbe Anzahl von Bergen, die ich schon auf dem Herweg bewältigt hatte, nichts ausmachen.

Morgens in den norwegischen Bergen, abends an einem schwedischen See: das Motto meines nächsten Reisetages. Ich war in Häljeboda angelangt. Meine Freude, der norwegischen Ungewissheit endlich entronnen zu sein, war so groß, dass es mich nicht groß störte, als ich die Gastgeber des weißen Häuschens am See nicht erreichte. Sie gingen nicht an ihr Handy, antworteten nicht auf SMS. So hing ich am Haus ab, übte mich in Geduld und suchte nach Unterkünften für die nächsten Etappen. Es war wie ein Game, das man von Level zu Level bestritt und in dem man immer wieder Aufgaben zu lösen hatte: Finde ein Hotel. Suche einen Parkplatz. Mache dich auf die Suche nach einer Wechselstube. Ich fand ein günstiges Hotel in Stockholm in Schiffs-Style, mit Kojen als Betten. Es klopfte an der Scheibe. Mein Gastgeber überreichte mir den Schlüssel zum Haus, meinte zum Abschied, ich sollte ihn morgen früh einfach in der Tür stecken lassen.
Endlich ausschlafen. Kein Zwang, in aller Herrgottsfrühe im Frühstücksraum zu erscheinen, um mich vollzustopfen. Hier war ich auf mich allein gestellt. Nur der See und ich.
Und dann Kumla. Der Ort war so unspektakulär wie sein Name und doch hatte er auf mich eine beruhigende Wirkung. Die Bed-and-Breakfast-Unterkunft lag einige Kilometer entfernt – die Rezeption war natürlich nicht besetzt. Der Eingangsbereich, der aus einem alten, schweren Holztresen bestand, war unverschlossen und es sah aus, als wenn hier seit Jahren niemand mehr empfangen worden wäre. Niemand zu sehen, dafür war an die Tafel in Kreide gekritzelt, unter welcher Nummer man die Gastgeber erreichen konnte. Ohne schwedische Vorwahl, die ich mir erst zusammenkombinieren musste. Den Herrn des Hauses erreichte ich im Zug, er bat mich, schon mal ins Haus zu gehen. Nein, nicht das große. Da würden seine Frau und er wohnen; das kleine war für mich reserviert. Es stünde offen.
Die Nacht verlief ruhig, es war aber bitterkalt, weil das Fenster nicht richtig schloss. Am nächsten Morgen fuhr ich weiter.
Ich habs nicht so mit Stockholm. Und Stockholm nicht mit mir. Ein stundenlanges Kreisen durch dichten Nachmittagsverkehr bildete meinen Einstieg in der Stadt. Immer wieder Baustellen umfahren, wenden, über einen Riesenumweg zurück. Ich fand das Hotel nicht, obwohl es irgendwo in der Nähe sein musste. Noch einmal wenden und einen Schlenker machen, weil die Straße für den Gegenverkehr gesperrt war. Erst in der Innenstadt wieder eine Wendemöglichkeit. Abbremsen. Die Fußgänger fühlten sich hier wie zuhause und ich musste sie gewähren lassen. Mir kam die Idee, noch näher ans Wasser zu fahren, dort, wo man parkte, wenn man einen Spaziergang am Wasser machen wollte. Da sah ich es: das Schiff mit dem Namen meines Hotels. Ein Schiff, wie aufregend. Das erklärte auch den günstigen Preis. Die Aufregung legte sich bald, als ich erfuhr, dass ich hier nicht parken dürfe, obwohl in der Beschreibung etwas von einer Parkmöglichkeit gestanden hat. Weiter hinten, am Terminal, wäre eine riesige Parkfläche, erklärte man mir an der Rezeption. Für die man, wie ich feststellte, nur mit Kreditkarte zahlen konnte. Doch ich kannte mich mittlerweile aus, fuhr die Straße, die ich heute schon etliche Male entlanggefahren war, einfach weiter, bis es ruhiger wurde, parkte ein, und wurde mit der bitteren Wahrheit konfrontiert: auch hier nur Handyparken oder Parken mit Kreditkarte möglich. Stieg ein, fuhr weiter, auch wenn das jetzt wohl schon eine Stunde Fußweg bedeutete. Auch hier durfte ich nicht stehen. Ich fragte jemanden, der sich auszukennen schien, nach einem Parkplatz mit einem Geldautomaten. Kopfschütteln. Stieg wieder in den Wagen, fuhr in die Innenstadt, auf der Suche nach einem Parkhaus, das sich auf meine EC-Karte einlassen würde.
Und hatte Glück. Oder war es eher Unglück im Glück? Die Gebühr fürs Parkhaus des Sheraton-Hotels betrug 45 Euro. Pro Nacht. 90 Euro für zwei Nächte. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Der Weg zurück zum Botel war steinig, auch für Fußgänger. Das Navi hatte nicht mitbekommen, dass es in Stockholm ein Oben und Unten gab, dass ich gerade oben über eine Brücke gegangen war, das Hotel sich aber unten an der kreuzenden Straße befand. So schickte mich mein Handy immer wieder im Kreis, ich verstand die Welt nicht mehr, wurde zunehmend unruhiger, weil auch hier trotzdem irgendwann die Dämmerung hereinbrach, die die letzten Menschen vom Uferweg vertrieb.
Kurz vor Mitternacht erreichte ich das Botel und hatte Schwierigkeiten, meinen Koffer einzulagern. Er passte gerade so in die Kajüte, ließ sich aber nur einen Spalt breit öffnen. Immerhin konnte ich auf ihm sitzen, wenn ich an dem winzigen Waschbecken meine Zähne putzen wollte – an Klaustrophobie sollte man hier lieber nicht leiden. Doch für heute würde es gehen, war ich mir sicher, so ermattet, wie ich war.
Es ging nicht. Ob’s nun an der lärmenden Lüftung lag oder an der Zugluft, die durchs Zimmer zog, an den Türen, die hier und da permanent zugeknallt wurden, am gedämpften Babygeschrei, das den Verschlag noch klaustrophobischer wirken ließ: Ich wachte morgens mit einer Nackenverspannung auf, die sich gewaschen hatte, absolvierte angestrengt die obligatorische Hop-on-hop-off-Tour mit Bus und Boot, nahm alle Sights mit, war genervt von den Touristen, den hohen Preisen, von allem, sodass ich am Abend meinen Wagen vom Sheraton-Parkplatz nahm, ihn ruhig durch die vollgestopften Straßen bugsierte und meinen Koffer klammheimlich aus dem Loch entwendete . Noch eine Nacht hier würde ich nicht überstehen. Ich verlor zwar 60 Euro, die ich bereits im Voraus gezahlt hatte, ersparte mir dafür aber weitere 45 für den Parkplatz.
Der geneigte Analyst möge bitte hier eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Meine fiel durchaus positiv aus, auch wenn ich am späten Abend noch hinuntergurken musste in die nächste Stadt. Erschöpft, aber voller Euphorie steuerte ich Norrköping an, in dem ich mir bereits eine Unterkunft herausgesucht hatte.
Es war fast nicht verwunderlich, dass niemand aufmachte, als ich nach Einbruch der Dunkelheit an der Tür klingelte. Aber auch hier gab es eine Informationstafel mit einer Telefonnummer – die Vorwahl kannte ich bereits. Niemand ging ran. War dies der Tag, an dem meine Bettdecke vom Rücksitz zum Einsatz kommen würde?
Nein, dieser Tag war noch nicht gekommen. Der nette Besitzer des Hotels rief mich zurück, nannte mir den Geheimcode für die Eingangstür und den Kasten, in dem die Schlüssel aufbewahrt wurden. Der Rest war Magie. Natürlich konnte es nach Stockholm nur noch aufwärts gehen, aber gleich so! Ein üppig ausgestattetes Zimmer mit breitem Bett und flauschigen Handtüchern, die ich gleich nutzen würde – sobald ich umgeparkt hatte.
An der Straße war selbstredend Halteverbot, doch Halt! Wie lautete nochmal der Code für die Eingangstür? Sollte ich den freundlichen Herrn noch einmal anrufen? Ich schob kurzerhand die Fußmatte unter die Eingangstür, stellte den Wagen auf dem Hotelparkplatz ab – und sank wenige Zeit später in die weichen Kissen.
Da Norrköping keine Attraktionen hatte, kam ich früh los und wollte es trotz besseren Wissens wieder mit einer Jugendherberge versuchen, diesmal in Jönköping. Entspannte Fahrt dorthin, nette, saubere Unterkunft, an einem malerischen See gelegen, doch unterwegs nirgends ein Caffè Latte, in keiner Gaststätte, an der ich hielt. Nur normaler Kaffee, das olle Gesöff, das ich ganz sicher nicht hinunterbekam. Bei Ikea, wo ich mir drei 1-Euro-Hotdogs reinzog, hatten sie zwar welchen, doch da war es schon zu spät: Meine Nackenverspannung von Stockholm hatte sich zu einem Brettnacken entwickelt. Ich hatte Kopfschmerzen, hatte die Nase voll. Sodass ich auf dem Weg nach Ystad am Folgetag spaßeshalber Hamburg als Ziel meiner Reise angab. 5 Stunden, 50 Minuten, sagte das Navi. Ich sagte „Okay, Navi, bring mich hin“, trat aufs Gaspedal und peste durch, obwohl ich ab Trelleborg eine Autofähre nach Lübeck gebucht hatte und unterwegs zwei Unterkünfte in luxuriösen Chalets.
Auf der Autobahn durch Dänemark gab ich Gas, hielt nur an, wenn es gar nicht anders ging, war inzwischen so geübt wie eine Lkw-Fahrerin, die die Cola-Flasche mit einer Hand öffnen konnte, fuhr immer weiter. Zwölf Stunden dauerte die Fahrt, wovon die letzte die schlimmste war.
Kurz vor Hamburg wurde es dunkel. Die Rücklichter der Autos vor mir blendeten meine kopfschmerzgeplagten Augen, an der Dauerbaustelle bei Hamburg-Schnelsen blinkte es in den verschiedensten Farben, und auch der strömende Regen trug nicht wirklich dazu bei, dass ich etwas sah. Ich fuhr auf gut Glück, direkt in Hamburg dann nur noch mit 20 km/h; mehr war nicht drin. Die anderen Verkehrsteilnehmer hatten Verständnis, zumindest bekam ich nichts Gegenteiliges mit.
Nach Mitternacht fiel ich mit dem Gesicht nach vorn endlich in mein eigenes Bett. 4000 Kilometer. Check.
Du brauchst mehr Action? Dann schnall dich mal an – wir heben ab!
Nackt in der großen Stadt
Näher am Äquator
Der Hund mit dem Winkepfötchen. Eine Flughafen-Story.
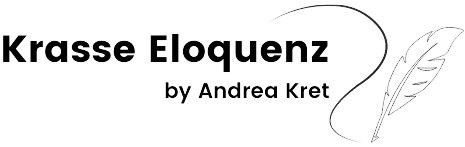



Pingback: Der Hund mit dem Winkepfötchen. Eine Flughafen-Story. – Krasse Eloquenz
Pingback: Nackt in der großen Stadt – Krasse Eloquenz