Im Trittauer Gewerbegebiet unweit von Hamburg, da ist die Welt noch in Ordnung – so dachte man lange Zeit. Unlängst, in einer Januarnacht, wurde dieses Axiom widerlegt: Die Überreste eines Zigarettenautomaten, das Gehäuse und die Innereien, hingen kläglich an der Befestigungsstange herunter. Es wurde ausgeraubt, das arme Ding. Ein deutliches Zeichen. Nach den sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht war es an der Zeit zu handeln, Zeit, etwas für die eigene Sicherheit zu tun. Wenn man wie ich jahrelang zum Karatetraining gelatscht war, könne man unbesorgt sein, meint mancher. Doch er irrt. Erkenne dich selbst, heißt es dort ganz philosophisch, erkenne deinen Gegner. Karate sei wie warmes Wasser, das ständig zu erwärmen ist, damit es nicht abkühlt. Pausenlos trainieren, in langen Sessions Holzdielen schrubben – wie Ralph Macchio in Karate Kid. Natürlich. Ich gebe zu: Ich habe mein Karate lange nicht erwärmt und so war es bestenfalls nur noch lauwarm. Eine schnelle, zweckdienliche Methode musste her: Ich googelte nach Ninjautensilien.
Im Onlineshop fiel mir die Wurfaxt sofort ins Auge, handlich und praktisch. Die Wurfsterne waren auch nicht zu verübeln. Ein 10er-Kunai-Wurfmesserset wurde da präsentiert, das man notfalls auch in der Küche einsetzen konnte. Auch bei den Tabisocken, die zu den Tabischuhen mit separatem großen Zeh passten, hatte man mitgedacht: Sie ließen sich von improvisationsfreudigen Hobbyninjas auch in normalen Tretern tragen, in denen man keine Seile hochklettern musste. Mein Liebling war die Kettenpeitsche mit scharfen Kanten und extrem hoher Wirksamkeit. Während man beim Ninja den Gegner nach Gusto in allen erdenklichen Formen verhackstücken konnte, war Karate Do sogar ganz wörtlich der Weg der leeren Hand. Wieder den falschen Sport trainiert.
Mit leeren Händen verließ ich den Onlineshop, wollte es bodenständiger versuchen, stieß bei meiner Recherche auf einen Spezial-Selbstverteidigungsschirm und erinnerte mich an eine ältere Dame aus einem noch älteren Selbstverteidigungsbuch, die ihrem Opponenten sogar mit einem handelsüblichen Schirm eins übergebraten hatte. Dazu brauchte sie nicht einmal die Gusseiserne aus der Küche. Der Schirm schien mir nicht geeignet, auch wenn er zum Hamburger Dauerregen gepasst hätte. Ich klickte auf den Klassiker, das Pfefferspray, und erfuhr, dass man sich beim Einsatz dieser Waffe exakt in Windrichtung positionieren müsse. Sonst spielte man dem Gegner direkt in die Hände – wie seinerzeit der ahnungslose Bruce Lee in einem seiner Filme, in dem er einen Einfaltspinsel abgab, der aus heiterem Himmel ein Nunchaku in die Hand bekam und es sich selbst auf den Dötz schlug. Der Schlagring, den ich mir danach anschaute, war ganz nett, jedoch verboten. Auch vom Schlagstock riet man ab, da man damit den Kontrahenten zwar gekonnt vermöbeln konnte – später, vor Gericht würde es aber unangenehm werden – und nicht ganz billig. Beim Elektroschocker gab es das Problem, dass sich die Batterie, wenn nicht regelmäßig genutzt, selbstständig entlud. Daher war hier angeraten, mit dem Teil ab und an auf der Straße herumzuspazieren und es an ahnungslosen Passanten zwischenzutesten. Bei der Gaspistole warnte man vor einer Eskalationsgefahr. – Nein, das wollte ich wirklich nicht.
Ich entschied mich für den Schrillalarm, ein harmlos daherkommendes Utensil, das man um den Hals trug. Im entscheidenden Fall zog man an einem der Teile, das Ding ging los, der Bösewicht, der gerade dabei war, einen zu überfallen, erschrak, lief davon. Ende gut, alles gut.
In der Anpreisung des Artikels im Netz vergaß man jedoch zu erwähnen, dass der Alarm die Lautstärke eines Düsenjets hatte und man davon taub wurde. Da drängte sich gleich die Frage auf: Was ist wohl schlimmer, vergewaltigt zu werden – oder taub? Und was, wenn man taub würde und der Mann wollte nur nach Feuer fragen? Hier könnte man zu Recht von Tragik sprechen.
Ich schob den Gedanken beiseite und kroch unter die Decke, um den Alarm auszuprobieren. Kam wieder hervor, packte noch eine weitere Decke oben drauf – nicht dass die Nachbarn meinetwegen die Polizei holten. Für das Schreiben meiner Magisterarbeit hatte ich Baustellenohrenschützer geschenkt bekommen, weil just zu jener Zeit der Nachbar über mir seine Wohnung komplett neu saniert hatte. Ich setzte den Gehörschutz auf, tauchte erneut unter die Decken, hielt den Alarm unter das Kopfkissen, hielt den Atem an.
Und zog.
Nichts passierte. Kein Ton, nicht einmal das leiseste Fiepen. Ich warf die Decken von mir, behielt die Ohrenschützer auf, begutachtete den Alarm, setzte ihn wieder zusammen. Und noch einmal unter die Decke.
Angstvoll zog ich am Faden.
Nichts. Das Höllengerät funktionierte einfach nicht. Ein Zeichen, wieder einmal. Ich schickte den Alarm am Folgetag ein und bestellte mir stattdessen aus dem Internet ein handliches Schwert und eine Schwingkeule, ohne die ich fortan nicht das Haus verließ.
Hier geht es zu einer weiteren Karatesatire: Ichi, ni, san
Ich habe auch Sensei Thomas Volkmann (6. Dan) interviewt: „Beim Karate gibt es keine Regeln“
Titelfoto: © iStock/MilanMarkovic
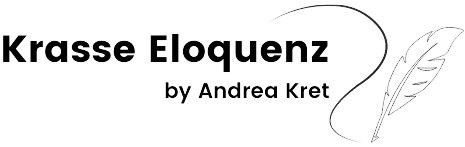



Pingback: „Beim Karate gibt es keine Regeln“ – Krasse Eloquenz
Pingback: Ichi, ni, san – Krasse Eloquenz
Pingback: Politisch? Korrekt! – Über die Gratwanderung beim Improtheater, über Abstürze und Höhenflüge – Krasse Eloquenz