„Schöner hauen“ lautet der Slogan vom Kyodo Dojo. Warum dort das Karate schöner ist als vielleicht woanders, warum Sensei Thomas Volkmann (6. Dan) nach so vielen Jahren immer noch Bock hat, auf der Matte zu stehen, erzählt er in diesem Interview. Und er verrät uns, was die schöne Emma Peel mit dem Ganzen zu tun hat …
Typisch Karate – meinen viele – ist es, per Handkantenschlag Ziegelsteine zu durchbrechen. Wie oft machst du das im Training?
Im Training?! Ziegelsteine? Also … im Training habe ich das in meinen 46 Karatejahren einmal gemacht. Ansonsten haue ich grundsätzlich nicht gegen etwas Hartes.
Ziegelsteine zu durchbrechen gehört standardmäßig also nicht zum Karatetraining?
Nee. Ich versuche so etwas zu vermeiden. Meine Hand war mal so schwer verletzt, weil ich gegen etwas Hartes geschlagen habe, allerdings nicht beim Karate. Ich war zu der Zeit etwas unausgeglichen. Da hat die Wand über mich gesiegt. (Lacht.) Zu der Zeit habe ich mir geschworen, nie wieder gegen etwas Hartes hauen, nicht einmal gegen harte Köpfe, denn auch da kann man sich die Hand böse verletzen. Es hat schon einen Grund, dass Boxer ihre Hände bandagieren und Boxhandschuhe tragen.
Ich habe noch mehr Karateklischees auf Lager: „Karate Kid“ war ja früher der Karatefilm schlechthin. „Daniel San“ hat stundenlang die Dielen geputzt oder den Zaun gestrichen – als Vorbereitung aufs Karate. Auf der anderen Seite gab es die Bösewichte, die Karate trainiert haben, um andere Menschen möglichst effizient zu verkloppen. Ist das Karate, was da im Film dargestellt wurde?
Menschen zu verkloppen?
Oder den Fußboden zu schrubben …
Traditionell ist das in Japan so, dass die Schüler nach jedem Training das Dojo putzen. Meist konzentrieren sie sich dabei auf den Boden, aber es gibt auch Dojos, wo die Schüler alles putzen, sie gehen sogar mit der Zahnbürste in die hintersten Ecken. In Japan haben die Schüler beim Bodenwischen einen Lappen und putzen von einer Seite zur anderen, dann übernimmt ein anderer, läuft wieder zurück – das ist sehr gut für die Bauchmuskulatur, für die Arme und die Achillessehnen. Es trainiert so einiges. Im Westen wird das nicht so praktiziert; hier sind wir ein bisschen anders drauf. In meinem Dojo beschränkt sich das nur auf den Boden – da helfen mir die Schüler, weil es mit fünf Freiwilligen schneller geht, als wenn ich es allein machen würde.
Und die andere Seite: Kommen in dein Dojo Leute, die möglichst gekonnt jemanden vermöbeln wollen? Oder wer trainiert bei dir?
Ich selbst habe so etwas bisher nicht erlebt. Einmal sind zwei Jugendliche übereinander hergefallen; das ist aber schon lange her und ich weiß nicht, worum es dabei ging. Da hörte der Spaß auf einmal auf. Das kann durchaus mal passieren, wenn verschiedene Temperamente aufeinandertreffen. Aber gerade das soll man beim Training lernen: dass man solche Ausbrüche im Zaum hält. Ein guter Karateka weiß, was er damit anrichten kann, und er lässt es auch.
Bei mir trainieren hauptsächlich „Kopfmenschen“, also solche, die am Schreibtisch sitzen und geistig sehr gefordert werden – aber eben nicht körperlich. Diese Menschen werden auch extrem vom Karate angezogen.
Was ist denn überhaupt Karate? Ist es eine Sportart? Ist es eine Kunst im Sinne von Kampfkunst? Vielleicht eine Philosophie? Oder eine Art von Meditation? Wie siehst du das?
Das trifft alles zu. Für mich ist Karate auch eine Art von Meditation in der Bewegung. Ich bin dadurch ausgeglichen. Ich habe häufiger erlebt, dass Menschen, die sich langsamer bewegen – zum Beispiel beim Tai-Chi –, häufig nicht ganz so ausgeglichen sind. Es gibt ja Yin und Yang, und die haben zu viel vom Yin – sie können die Energie nicht so rauslassen, wie man es beim Karate tut. Oder generell bei intensiveren Sportarten. Für Körper und Geist ist es ganz gut, wenn man etwas macht, bei dem man sich so richtig auspowern kann. Das fördert zudem die geistige Hygiene.
Und zum Aspekt der Kampfkunst: Es hängt immer von demjenigen ab, der es unterrichtet. Für mich ist es eine Kunst: Jeder kommt mit unterschiedlichen Motiven zum Training und versucht, dort unterschiedliche Dinge zu finden und zu verwirklichen. Für mich ist das lange kein Sport mehr, obwohl ich es auch als Sport betrieben habe. Da hatte ich Trainer – und keine Senseis, gute Trainer. Trainer und Senseis begleiten einen auf unterschiedliche Arten.
Ich habe mein Dojo früher tagsüber an Tanzschulen untervermietet und habe es bedauert, wenn die tollen Tänzerinnen nach den drei Jahren ihrer Ausbildung die Schule verlassen haben. Das wäre für mich ziemlich unbefriedigend. Ich habe Schüler, die teilweise 30 Jahre bei mir sind. Wenn ich denen etwas zeige und die mich ansehen, dann weiß ich: Da ist etwas rübergekommen. Ich merke, dass sie begeistert und beeindruckt sind – auch nach so vielen Jahren.
Du hattest es ja schon kurz angeschnitten: Es gibt beim Karate eine Etikette. Was gehört neben dem Bodenputzen noch dazu?
In manchen Dojos wird vor dem Training die Dojokun aufgesagt, also die Verhaltensregeln: „Vervollkommne deinen Charakter“, „Sei höflich“ und noch einige andere. Das ist nichts Schlechtes, aber ich mache es nicht. Bei mir hängen die Regeln vorn an der Stirnseite. Wir verbeugen uns auch zur Vorderseite hin, wenn wir an- und abgrüßen. Ich finde, damit ist alles gesagt.
Du meintest, manche deiner Schüler seien schon sehr lange dabei. Wie hält man so lange durch? Was hält dich und deine Schüler bei der Stange?
Unter anderem die Gemeinschaft. Und die Tatsache, dass wir uns zusammen weiterentwickeln. Da ich meinen Schülern ein wenig voraus bin, kann ich ihnen immer etwas geben, egal, auf welchem Niveau sie sind. Daran können sie arbeiten und reifen, körperlich und geistig. Im Karate ist es so, dass die wichtigen Dinge diejenigen sind, die man nicht sieht.
Zum Beispiel?
Man lernt führen. Oder sich führen zu lassen. Sich richtig zu verhalten. Mein ehemaliger Trainer, Dr. Peter Schröder, hatte Manager großer Unternehmen ausgebildet. Er sagte mir damals, dass ihm das Karate sehr dabei geholfen hat, Dinge zu vermitteln, vor vielen Menschen zu sprechen. – Karate lehrt so vieles.
Das heißt, beim Karate kann man etwas fürs Leben mitnehmen?
Ohne Karate wäre ich vermutlich nicht so ein zufriedener Mensch. Ich freue mich, dass meine Eltern mich zu nichts gedrängt haben. Ich war keinem Druck ausgesetzt, etwas machen zu müssen. Das ist in manchen Familien anders. Meine Eltern hatten Vertrauen in mich und haben immer gesagt: „Aus dem wird schon was.“ Wären sie anders gewesen, würde es dieses Dojo wahrscheinlich nicht geben. Ich habe vor, das bis an meine Lebensende zu machen. Mein Mietvertrag läuft aus, wenn ich 79 Jahre alt bin. So lange möchte ich das machen. Und ich würde mich freuen, wenn sich ein Schüler herauskristallisiert, der es dann weiterführt.
Du machst jetzt seit 46 Jahren Karate. Wie waren die Anfänge? Warum hast du damit angefangen?
Den Erstkontakt hatte ich durch Emma Peel aus dem Film „Mit Schirm, Charme und Melone“. (Lacht.) Das war die erste Frau, in die ich mich verliebt hatte. Sie war sexy gekleidet und tough. Rückblickend betrachtet, mit meinem heutigen Wissen, weiß ich, dass sie in puncto Kampfsport nicht viel konnte. Dadurch allein bin ich aber noch nicht zum Karatetraining gekommen.
Mit 17 war ich in der Schule mal ziemlich verhauen worden, ohne dass ich jemanden provoziert hätte. Vermutlich wollte der andere irgendwelche Spannungen abbauen. Ich war ihm körperlich nicht gewachsen – nicht meine Gewichtsklasse. Als ich nach Hause kam, war mein Vater entsetzt. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie er in die Schule lief. Danach habe ich gedacht: So etwas möchte ich nicht nochmal erleben.
Hinzu kam, dass meine Eltern einer Buchgemeinschaft angehörten, in der sie sich monatlich Bücher aussuchen konnten. Einmal meinte meine Mutter, ich könne mir ein Buch aussuchen – und da war dann ein Karatebuch. Als das kam, habe ich es mit Interesse gelesen und es in den Bücherschrank gestellt – wie das immer so ist.
Schließlich hat ein Klassenkamerad an einer weiterführenden Schule gemeint: „Willst du mal zum Karate mitkommen?“ Damals war das Karate auf eine gewisse Weise härter als heute. Was ich da alles beobachten konnte … das war schon ziemlich heftig. Dass ich damals den Vertrag überhaupt unterschrieben habe … (Er lacht.)
Hast du zwischendurch mal gedacht: „Ich hab jetzt keinen Bock mehr! Ich höre auf“?
Ja. Selbst Kanazawa Sensei, der vor ein paar Jahren hochbetagt gestorben ist, hatte solche Phasen. Und das mit dem 10. Dan, also dem 10. Meistergrad. In solchen Augenblicken ist er ins Dojo gegangen, hat dort Karate trainiert und gedacht: „Nee, ist doch gut.“ Er ist bis zum Schluss – mit fast 90 Jahren – beim Karate geblieben.
Ich selbst war durch den sportlichen Wettkampf an einem Punkt, wo ich überlegt hatte, ob ich weitermachen soll. Hinzu kam ein Trainerwechsel. Zu der Zeit habe ich Janusz Knapczyk kennengelernt, der mir Dinge gezeigt hat, die es auch noch im Karate gibt. Er hat mein Interesse wiedererweckt und mich dazu gebracht dabeizubleiben; dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wenn er mir nicht die interessanteren Dinge gezeigt hätte, würde es mein Dojo vermutlich nicht geben. Mit ihm bin ich heute noch befreundet, wir trainieren momentan einmal die Woche zusammen.
Dein Dojo gehört zum JKA, also zum japanischen Karateverband, und nicht zum Deutschen Karate Verband. Warum ist das so?
Loyalität gehört auch zum Karate. Meine Trainer haben sich damals an Ochi Sensei orientiert. Das ist der Japaner, der von der JKA nach Deutschland geschickt wurde. Er ist Chief Instructor vom Deutschen Karatebund geworden, der mit der Deutschen Karate Union fusionierte und zum Deutschen Karate Verband wurde. Ochi Sensei war mit der damaligen Situation nicht zufrieden, weil es nicht mehr das Karate war, das er ursprünglich in Japan gelernt hatte. Das Wettkampfkarate hatte sich extrem verändert, nicht nur zum Positiven. Man hatte das Gefühl, dass sich die „neuen“ Kämpfer im Kampf nicht mehr benehmen konnten. Die Nationalmannschaft war damals auch weniger erfolgreich als vorher. Ich war es auch nicht mehr in dem Ausmaß. Das lag daran, dass sich die Kriterien zwischenzeitlich geändert hatten. Wir fühlten uns da alle nicht mehr so wohl. Irgendwann hat Ochi Sensei den DJKB gegründet, den Deutschen JKA-Karate Bund. Da gehört schon etwas dazu, wenn ein Japaner seinen Arbeitgeber verlässt …
Das war aber ein guter Schritt, und es sind auch in etwa 20.000 Karateka aus dem DKV ausgetreten und haben den Weg von Ochi fortgesetzt.
Du hast eben gesagt, manche Kämpfer konnten sich nicht benehmen. Was meinst du damit? Haben die zugeschlagen?
Nein, da wird man disqualifiziert. Da können die ganz schnell duschen gehen. (Lacht.) Nein, es geht um die Art und Weise ihres Auftretens. Ich will das an einem Beispiels veranschaulichen: Wenn man früher vor einem sportlichen Gegner stand, noch bevor der Kampfrichter den Kampf eröffnet hatte, hat man seine Arme ganz entspannt hängen lassen. Diese Kämpfer hatten aber ihre Hände in der Taille, um sich größer zu machen. Das war schon eine Provokation. Auch war es so, dass man sich am Ende eines Kampfes voreinander verbeugt hat – ob Sieg oder Niederlage. Viele haben sich da anders benommen. Das wollten wir nicht mehr; für uns war das kein Stil, sondern eher flegelhaftes Verhalten, und es kam immer häufiger vor.
Was unterscheidet das Karate in Deutschland von dem in Japan?
Das in Japan ist sehr sport- und wettkampforientiert. Man arbeitet dort vorrangig mit Kindern oder Studenten. Sie nehmen an Wettkämpfen teil – und nach Abschluss ihres Studiums treten sie dann in die Arbeitswelt ein – von da an sind sie für das Karate verloren, sie kommen nicht mehr dazu. In Deutschland ist das anders. Bei uns ist das Karate ein lebensbegleitender Weg.
Eine Regel beim Karate lautet „Es gibt keinen ersten Angriff“. Was genau ist damit gemeint?
Da oben steht das! (Thomas zeigt auf die Wand hinter sich, an der japanische Schriftzeichen hängen.) Man sagt auch „Karate ist für die Gerechtigkeit“. Man sollte keinen Kampf eröffnen, es nur anwenden, wenn man angegriffen wird und es nicht vermeiden kann. Ansonsten sollte man darauf verzichten. Ich bin froh, dass ich es noch nie brauchte. Eigentlich doch, aber es ist nicht dazu gekommen. Man bekommt eine gewisse Selbstsicherheit und diejenigen, die dann eventuell vor einem stehen, spüren das. Dadurch kann man auch vieles vermeiden. Es gilt vor allem, ruhig zu bleiben.
Sagst du dann „Ich kann Karate“?
Nein! (Lacht.) Mit dem Karate kann man schlimme Dinge machen. So, wie ich das betreibe, mit allem, was man in der Kata findet, also in der Karate-Form, ist das kein Spiel. Damit kann man vieles anrichten; das geht weit über den Sport hinaus.
Ein Bekannter mit einer hohen Graduierung, der Sportkarate praktiziert, war in einer Selbstverteidigungssituation extrem überfordert, weil ihn einer gewürgt hatte. Er war überfordert, weil er es nicht geübt hat, wie man solche Situationen überstehen kann.
Karate ist eine knallharte Kampfkunst. Da gibt es auch keine Regeln mehr. In jedem Sport gibt es Regeln, beim Karate nicht. Ursprünglich war es dazu gedacht zu überleben. Wenn man Karate so benutzt, wie man es benutzen könnte, ist es so, als würde man eine Schusswaffe ziehen und abdrücken.
Was heißt denn „Es gibt keine Regeln“?
Ein Beispiel wäre, dass man in die Augen sticht und wirklich böse Sachen macht. Ursprünglich ist Karate entwickelt worden, damit die Menschen auf Okinawa sich gegen die Samurai schützen konnten, die Schwerter trugen. Sie selbst durften keine Waffen besitzen, mussten sich deshalb anders wehren. Zuerst hatten sie sich auf das Kobudo konzentriert, den Kampf mit Bauernwaffen – Nunchaku und was es alles so gibt – und eben auch auf Karate, den „Weg der leeren Hand“.
Was rätst du denn jemandem, der in eine solche Situation kommt und kein Karate kann?
Weglaufen!
Gichin Funakoshi, der „Vater des modernen Karate“ hat mal gesagt, dass man Orte meiden sollte, die gefährlich sein könnten. Da fängt es schon an.
Also nicht um drei Uhr nachts über den Kiez ziehen …
Genau! Das sollte man vermeiden.
Worauf kommt es an, wenn du im Dojo gegen jemanden kämpfst? Was macht einen guten Kämpfer aus?
Das spielen ganz viele Faktoren mit rein. Ganz wichtig ist die innere Haltung. Die Kontrolle, der Fleiß, die Hingabe, mit der jemand Karate praktiziert. Es geht nicht nur um die Technik.
Was ist deine Lieblingstechnik? Oder deine Lieblingsform/Lieblingskata?
Das kann ich gar nicht so sagen. Meine Lieblingstechnik ist diejenige, bei der ich spüre, dass sie in dem Moment absolut effektiv ist. Und kontrolliert. Bei der man weiß: Wenn ich es gemacht hätte, hätte es ein großes Problem gegeben. Aber diese absolute Kontrolle und die Sicherheit, dass derjenige gesund nach Hause geht – das ist ein schönes Gefühl. (Lacht.)
Früher habe ich wie im Pumakäfig trainiert; wir sind wirklich ganz schön aufeinander losgegangen. Mein Trainingskamerad, der auch ein Dojo führt, meinte mal: „Wenn wir heute noch so trainieren würden wie früher, hätten wir kein Dojo.“ Wir hatten uns gut beharkt, haben aber immer Acht gegeben, dass jeder gesund nach Hause kam. Das fand ich gut.
Ich bin sogar parallel einmal die Woche zum Boxen gegangen – auch da haben alle aufeinander Acht gegeben, damit beim Sparring nichts passiert. Ganz vernünftig. Dort habe ich mich ebenfalls wohlgefühlt. Vor allem war das viel lockerer als beim Karate.
Ja?
Zu dem Zeitpunkt war ich auf Disziplin trainiert worden; das war fast schon militärisch. Die Boxer waren sehr gut, zugleich aber sehr locker, auch während des Trainings. Gerade die älteren habe ich als total angenehm erlebt. Es wurde viel gelacht – und so versuche ich das auch hier im Dojo. Ich habe die Art, das Training zu führen, von ihnen übernommen – wie sie mit den Schülern umgingen.
Wer eine Zeit lang ein wenig Schliff kriegen möchte, der kann das machen. Schaden tut es nicht. Aber immer so weitermachen, nee, das war nichts für mich.
Hat es denn beim Training schon mal Verletzungen gegeben?
Karate ist nicht sehr verletzungsträchtig. Natürlich hat es hier schon mal welche gegeben – das Kyodo Dojo gibt es jetzt seit 26 Jahren. Aber das ist sehr überschaubar. Einer hatte keinen Tiefschutz an und hat – und das ist schon eine gravierende Geschichte – später einen Hoden verloren. Das ist nicht so lustig. Ich kann mich auch an einen abgebrochenen Schneidezahn erinnern.
Das sieht dann nicht mehr so gut aus …
Ansonsten müsste ich wirklich noch überlegen … da war nicht so viel. Aber was meinst du, was in 26 Jahren beim Fußball oder Handball passiert? Allein an einem Wochenende gibt es da so einige Vorfälle. Beim Karate passt man sehr auf.
Früher sind wir immer zum Hansepokal vom Deutschen Karate Bund gegangen – ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt –, nie zur Hamburger Meisterschaft vom DKV. Wir haben an der Hamburger Meisterschaft, bei der man sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren konnte, nie teilgenommen, weil es da sehr viele Verletzungen gab. Ich kann mich an eine Hamburger Meisterschaft erinnern, bei der es 50 Verletzte gegeben hat. 50! Einer hatte einen Leberriss; das ist lebensbedrohlich.
Wir hatten unseren Hansepokal. Da kann ich mich an einen Nasenbeinbruch erinnern – und sonst nichts. Wir wollten uns sportlich auseinandersetzen und sind fair miteinander umgegangen.
Das Karate, das ich bei der Olympiade gesehen habe, ist nicht das Karate, wie ich es toll finde. Ich habe auch tolle Aktionen gesehen, so ist es nicht! Es ist nicht alles schlecht. Ich habe auch Achtung davor, wenn jemand da erfolgreich ist, aber es ist etwas anderes. Jeder muss selbst wissen, wie er trainieren möchte. Ich unterrichte ohnehin kein Sportkarate hier. Das würde mich sehr langweilen.
Wie würdest du es nennen, was du hier machst?
Ich habe sehr viel Koryû Uchinâdi bei Patrick McCarthy gemacht; das ist „altes Karate“. Hört sich verstaubt an, aber es umfasst sehr viel: Hebel, Würfe – wie beim Jiu-Jitsu. Es ist ein weites Feld. Wenn man in einer Kampfsituation ist, kann man nicht sagen: „Ich darf dich jetzt nicht hebeln oder werfen.“ Das ist im Rahmen der Versportlichung getrennt worden. Wenn man wirklich ums Überleben kämpft, ist alles erlaubt.
Ich habe einen Schüler, der den 4. Dan im Aikido hat – er sagt oft zu mir: „Das, was du da eben gemacht hast, das ist Aikido.“ Im traditionellen Karate ist das alles mit drin. Auch beim Jiu-Jitsu ist alles drin. Man kann auch Karate-Jitsu machen. Das ist es eher, was ich mache. Ich gebe hier auch Basistraining, was ganz wichtig ist, damit alle Schüler eine gute Grundlage haben.
Kanazawa hat mal gesagt: „Die beste Selbstverteidigung ist Gesundheit.“ Das war ein ganz schlauer Sensei. Durch das Karate versuche ich auch, meinem körperlichen Verfall entgegenzuwirken. Ich bin bald 64 und topfit. Mein Orthopäde sagte, meine Hüfte sei noch jungfräulich. (Er lacht.)
Thomas, ich wünsche dir weiterhin gute Gesundheit und bedanke mich für das spannende Gespräch!
Hast du so richtig Lust auf das Karatetraining bekommen? Hier geht es zum Kyodo Dojo in Hamburg.
Oder lies eine Satire zum Thema Selbstverteigigung für Frauen: Wurfmesser und andere Nützlichkeiten.
Und natürlich darf eine echte Karatesatire nicht fehlen: Ichi, ni, san
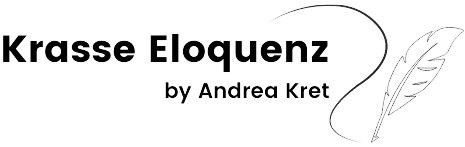


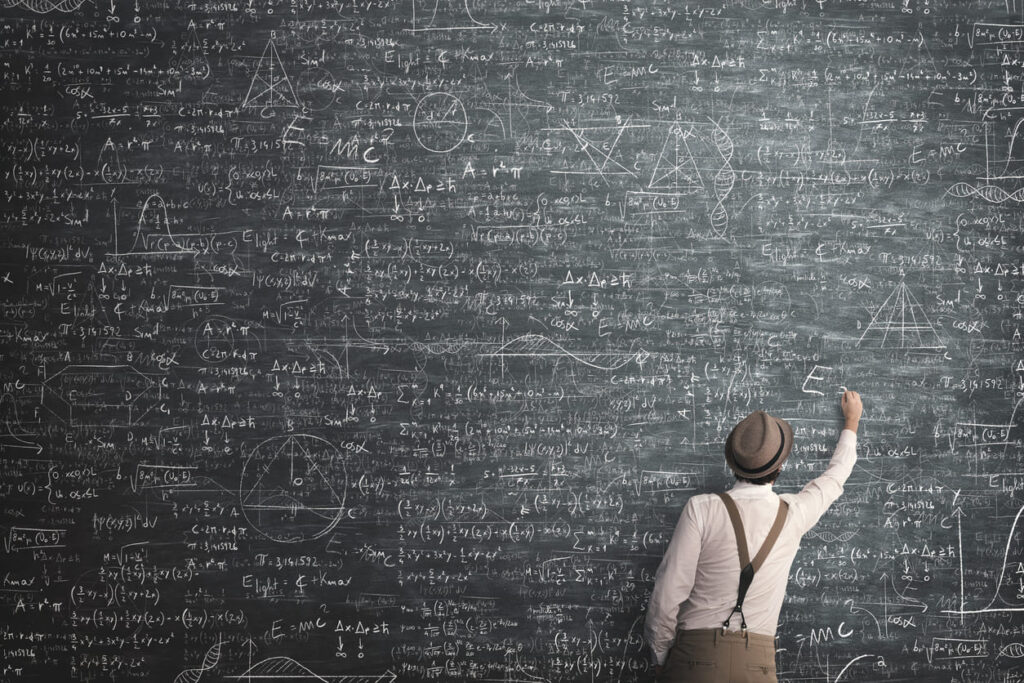
Pingback: Ichi, ni, san – Krasse Eloquenz
Pingback: Wurfmesser und andere Nützlichkeiten | Satire