Irgendetwas war anders hier. Und ich meine nicht die fehlenden Asiaten, die das Land offenbar noch nicht entdeckt hatten. Auch nicht die Abendfeuchtigkeit, die sich gleich nach meiner Ankunft auf mich legte. Das hier würde eine ganz andere Nummer werden. Bereits am Taxistand war es zu spüren.
Sie kennen es doch: Kaum steigt man im Ausland ins Taxi, schon wird man beschissen. So geschehen in Kroatien, wo ich mich gleich nach der Ankunft im Ort zu einer Taxischlange begab, dem ersten Fahrer die Adresse zeigte, dieser meinen Koffer einlud, mir die Tür aufhielt, den Motor startete, an der Ampel wendete, auf der gegenüberliegenden Straßenseite hielt, den Motor ausmachte. Wir waren am Ziel. Hier befand sich die Reiseagentur, die ich gesucht hatte. Ich drückte dem Taxifahrer schweigend einen Fünfer in die Hand.
Hier auf Malta gab es einen offiziellen Taxistand – an dem man im Voraus bezahlte. So etwas war mir noch nie untergekommen.
Ich überreichte den Mitarbeitern dort die seltsame Zieladresse, die mir Cindy von der Unterkunftsbörse als Treffpunkt genannt hatte. Ihre richtige Anschrift wollte sie, so nahm ich an, nicht verraten, weil sie als Frau alleine wohnte. Der Taxifahrer blickte mit Kennermiene auf den Zettel, verstaute mein Gepäck im Kofferraum; ich musste nicht umdenken, dass ich jetzt Beifahrerin war, und stieg wie gewohnt auf der linken Seite in den Wagen, der erfüllt war von einem Räucherstäbchen-Aroma. Nur noch Cindy Bescheid geben, dass ich unterwegs war …
… doch daraus wurde nichts, erklärte mir eine Frauenstimme auf Maltesisch durchs Handy; meine Karte war für das Land nicht freigeschaltet. Ich nahm an, dass sie genau das sagte, denn eine Telefonverbindung kam nicht zustande. Immerhin ließ sich der Taxifahrer überreden, bei meiner Gastgeberin anzurufen und uns anzukündigen. Geld wollte er dafür nicht, er schüttelte vehement den Kopf.
Wir erreichten Birkirkara, die Stadt, in der ich untergebracht werden sollte, der Fahrer verlangsamte in einem Wohnviertel, passierte einige Kreuzungen, fuhr bis zum Ende einer gottverlassenen Straße, wo verschrottete Lkw im Dämmerlicht herumstanden, ihr Innerstes nach außen gekehrt. Keine Häuser, keine Passanten. Ich hatte das P in den Augen, malte mir aus, dass er mich hier herauslassen wollte, schließlich hatte ich im Voraus bezahlt. Mit großem Koffer, unbrauchbarem Smartphone, ohne Cindy – in Malta, über das die Nacht hereinbrach.
Er besann sich eines Besseren, rief die Frau an, wurde lauter, drehte, kämmte das Viertel durch. Keine Cindy, kein Bert – diesen Namen hatte ich insgeheim dem weißen Mastiff gegeben, der Cindys Mitbewohner war. Genau wegen dieses Hundes hatte ich mich für jene Unterkunft entschieden. Das Kerlchen hatte mich so sympathisch von den Fotos im Netz aus angeblickt.
Das Handy des Taxifahrers klingelte. Ich glaube, es war Cindy. Sie sprach auf ihn ein, er aber wurde ungehalten, zerrte verärgert am Lenkrad, legte auf, redete in Halbsätzen in meine Richtung. Um ihn nicht zusätzlich zu reizen, blieb ich still, auch wenn ich gern darum gebeten hätte, dass er das Fenster öffnet, weil mir Schweiß den Rücken hinunterrann.
Er wendete wieder, wollte mich erneut in die Sackgasse mit den Schrott-Lkws bringen. Ich versprach kleinlaut, ihm den Zusatzaufwand zu bezahlen, wenn er mich da nicht herausließe, sondern lieber bei Cindy.
Genervt winkte er ab, stellte fest, dass in dieser Straße tatsächlich nur ausrangierte Fahrzeuge zu finden waren und keine Frau mit Hund, fuhr rückwärts heraus und dann nach oben. Hier waren wir noch nicht gewesen. „There! A lady with a dog“, stieß ich freudig aus. Von da an ging alles ganz schnell: Der Mann hievte mein Gepäck aus dem Kofferraum, redete dabei auf Cindy ein, die mich nicht einmal begrüßte, ich drückte ihm einen Zehner in die Hand, den er zuerst anstandshalber ablehnte, und dann waren wir oben in Cindys und Gustavs – nicht Berts – Reich.
Im Zimmer riss ich mir die verschwitzen Kleider vom Leib, daddelte noch auf meinem Smartphone herum (das Internet funktionierte immerhin) und ging schlafen. Versuchte es zumindest, denn das Schlafen stellte sich als Herausforderung heraus, was mich bei einer Tagesmiete von 17 Euro nicht sonderlich wunderte. In diesem Bett hatte schon so manch anderer Weltenbummler gepennt; es war durchgelegen, man versank darin. Die Mitte des Bettes bildete, sobald man sich hineinlegte, einen dezenten Krater. Kein allzu großes Problem, würden erfahrene Couchsurfer sagen. – Für einen Bauchschläfer schon! Im Yoga nannte man die Position, in der ich die Nacht verbrachte, sicher den „nach oben schauenden Hund“.
Apropos Hund: Der machte sich, sobald Frauchen am frühen Morgen aus dem Haus war, an meiner Zimmertür zu schaffen. Er kratzte daran, wollte mich dazu bewegen, mich um ihn zu kümmern, jetzt, wo er allein war. Ich ignorierte seine schamlosen Versuche. Was natürlich keinen Effekt zeigte: Gustav wurde raffinierter, rannte hinaus auf den großen Balkon und stellte sich vor mein Fenster, fing an zu bellen. Um zu sehen, ob es etwas brachte, kam er wieder von der anderen Seite angerannt, postierte sich vor meiner Tür. Ich gab mich geschlagen, verließ mein Zimmer, um ins Bad zu gehen, würdigte den Wicht keines Blickes.
Tagsüber sah Birkirkara nicht mehr bedrohlich aus. Lediglich zubetoniert, das aber auf eine schöne, orientalische Weise. Ein sandfarbenes Haus grenzte ans andere, ermüdete das Auge trotz der Monotonie nicht, weil der Anblick so ungewohnt war. Am Ende der Straße lag Bauschutt herum, eine Klosettschüssel, einige Plastikflaschen. Da, wo es zum Bus hinunterging, befand sich eine gewundene Treppe, die so verwinkelt war, dass die Bauarbeiter diese als ihr stilles Örtchen auserkoren hatten: Der Uringeruch war unverkennbar. Ich hielt die Luft an, bis ich unten war, sah dort schon einen Bus nach Valletta stehen. Flugs hinein.
Bereits dieser unbedachte Zug hätte dafür sorgen können, dass ich den Rest meines Urlaubs in Cindys durchgelegenem Bett verbrachte. Aufgeheizt durch die Nacht und den kurzen Marsch in der prallen Sonne, stand ich nun im Eisschrank. Der Bus war auf 18 Grad heruntergekühlt. Über mir zog es. Die Schweißtropfen auf meiner Haut hatten Zeit, sich zurückzubilden, bis ich an der Endstation wieder in den Hitzekäfig Maltas entlassen wurde. Wie konnten 31 Grad bloß so unerbittlich sein?
Ich hatte die Busfahrt ohne nennenswerten Schaden an meiner Gesundheit überlebt, hakte die Besichtigung Vallettas relativ schnell ab, auch wenn ich nur sehr langsam die Hügel hinauf- und hinunterkroch. Die Sonne stand ungünstig; die Stadt bot keinen Schatten. Am Bahnhof kaufte ich eine Wochenkarte für die Busse und beschloss hinauszufahren, in den Fischereihafen mit den farbenprächtigen Booten.

Diesmal zog ich mir meine Sportjacke an, doch die half wenig; meine Nackenhaare waren bereits schweißnass. War es nun ein Fluch oder ein Segen, als ich in Marsaxklokk ausstieg und mir die Hitze erneut entgegenschlug?
Neben den schönen Booten und einem kleinen Markt hatte der Ort nichts zu bieten, nicht einmal Schatten. Nur zahlreiche Bänke mit schöner Aussicht, auf denen niemand Platz nahm, der nicht lebensmüde war. Natürlich gabs auch hier etliche Cafés, doch ich fand, ein Urlaub konnte nicht daraus bestehen, sich von Café zu Café zu schleppen. Was tun? Ich blieb an der Ecke stehen, um auf meine Karte zu schauen und nachzudenken.
Von echtem Nachdenken konnte allerdings keine Rede sein; die Sonne brannte sich in mein Hirn und ich musste eine Hand auf den Hinterkopf legen, um das Ärgste zu verhindern. Ich machte kehrt und entdeckte unweit der Stelle, an der mich der Bus herausgelassen hatte, einen Unterstand mit vier Tischen und Bänken, der voll war von erschöpften Low-Budget-Touris. Sie hatten ihre Butterbrote ausgepackt. Ich setzte mich zu einer Familie an einen Tisch und überlegte, dass es höchst riskant wäre, in meinem Zustand wieder in einen unterkühlten Bus zu steigen. Aber ich war ich doch gut zu Fuß unterwegs! Immerhin ging mein Internet immer mal wieder, sodass ich über Google Maps ruck-zuck die kürzeste Route zu St. Peter’s Pool heraussuchte. Was auch immer das war. Es war zumindest am Wasser, und im Wasser, da war es kühl. Bei meiner Wandererfahrung waren fünf Kilometer ein Klacks.
Ich verließ die nette Familie, die mir sogar von ihren hartgekochten Eiern abgeben wollte, und folgte der blauen Spur auf meinem Smartphone, wechselte mehrmals die Straßenseite, wenn ich auf der anderen auch nur einen kleinen schattigen Fleck entdeckte, den ich mitnehmen konnte. Die Gegend wurde ländlicher, von malerischen Mauern umsäumt, die aus scheinbar achtlos aufeinandergeschichteten Steinen bestanden. Mein Wasser hatte ich längst ausgetrunken. Die maltesischen Autofahrer hielten regelmäßig neben mir, teils weil sie in mir eine irre Touristin zu erkennen glaubten, die vom rechten Weg abgekommen war und der man sicher ein paar Moneten abknöpfen konnte, teils aus Mitleid. Jeder wusste, dass man in Malta nicht zu Fuß auf der Straße unterwegs war, weil die Autofahrer sie als ihr Revier ansahen. Und in diesem Revier ging so einiges. Dass man auf der Insel nicht an Fußwege gedacht hatte, war nur ein bedeutungsloses Detail.
Ich schüttelte beharrlich meinen Kopf. Ich war eine Wanderin und würde das hier durchziehen. Bis zur Wasserquelle, die ich mittlerweile sehr nötig hatte. Der blaue Punkt in meinem Navigationsprogramm bewegte sich nur mühselig voran. So in etwa fühlten sich wohl die Leute beim Wüstenmarathon.

Lange Minuten später kam mir ein Pärchen entgegen, das ich mit verhaltener Freude begrüßte. Mitwanderer! Ich war nicht allein. Doch da waren noch mehr. Sie kamen von unten. Dort musste Wasser sein. „Is there the beach?“, wollte ich sagen, doch meine Zunge klebte schwer am Gaumen, sodass ich noch einmal ansetzen musste. Sie schüttelten den Kopf. Da sei nur der Hafen – dort war ich gestartet. Wie bedauerlich. Ich setzte meinen Höllentrip fort, begegnete immer mehr Menschen. Und einem Wasserstand. Unten sah ich St. Peter’s Pool, eine von Felsen umgebene Bucht. Endlich. In jeder Felsspalte hatten es sich Menschen weitestgehend gemütlich gemacht. Eine wurde gerade frei – ich legte meine Habseligkeiten ab und sprang direkt ins klare Wasser.
In Birkirkara traf ich zum Einbruch der Dunkelheit ein und wollte schnell noch an der Hauptstraße unten, wo alle Busse fuhren, etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen holen. Doch so breit die Straße auch war, so wenig konnte ich dort ein Lebensmittelgeschäft entdecken. Ich ging weiter, in die Richtung, aus der ich mit dem Bus gekommen war, passierte Geschäfte für Badzubehör, einen Motorradladen, dann über weite Strecken nichts. Verlassene Geschäfte mit eingeschlagenen Scheiben, Bauschutt in den Ecken. Vor einem Bürogebäude stand ein Pförtner und ich zog es in Erwägung, ihn nach einem Lebensmittelgeschäft zu fragen. Aber das war doch Quatsch! Ich musste nur einfach weiterlaufen, Richtung Valletta. Als es immer dunkler wurde und sich die Straßenarchitektur nicht änderte, kehrte ich um. Nun wollte ich tatsächlich den Pförtner fragen, doch der war verschwunden.
Als ich Cindys Wohnung erreichte, schaute die mich verständnislos an: Nein, unten an der Hauptstraße wäre kein Laden. Ganz oben, in der Nähe des Lkw-Friedhofs, den ich am Vortag mit dem Taxifahrer aufgesucht hatte, sei ein kleiner Supermarkt, ich müsse praktisch nur immer nach oben gehen. Ich merkte mir die Links-rechts-doppellinks-Kombination, die sie mir auf der Karte zeigte, und lief los, fand den Laden auf Anhieb und verkühlte mich fast beim Eintreten; der Schweiß gefror an der Türschwelle in Sekunden auf meiner Haut. Ich düste durch den Laden, suchte mir im Vorbeigehen die Sachen zusammen, die ich brauchte, und sah zu, dass ich hier wieder wegkam, bevor ich den Weg zurück wieder vergaß – jeder Winkel dieses Stadtteils sah identisch aus. Was, wenn ich das Haus, in dem Cindy wohnte, nicht wiederfand? Würde ich bis zum Morgengrauen durch die immergleichen Gassen irren? Den komplizierten Straßennamen hatte ich mir natürlich nicht gemerkt.
Ich fand die Wohnung, zum Glück! Gustav begrüßte mich hocherfreut, denn inzwischen war Cindy ausgegangen. Ich gab ihm etwas von den gekauften Stapelchips ab.
Die Nacht in meinem 17-Euro-Zimmer war mal wieder nicht ohne. Zwar hatte ich mir aus der Bettdecke, die ich hier ohnehin nicht nutzen konnte, eine Unterlage gebastelt, mit der ich das Loch in der Mitte stopfen konnte, doch die Luft zirkulierte in dem Raum einfach nicht. Ich tippte auf 31 Grad Innentemperatur und schlief nackt. So entdeckte mich Gustav, der am nächsten Morgen vor meinem bodentiefen Balkonfenster stand. Er war ganz ruhig, bellte nicht, allerdings hatte der Vogel, der in Cindys Küche wohnte, sein Morgenlied angestimmt, ein undefinierbares Gekrächze, das ich anfangs nicht zuordnen konnte und erst für eine kaputte Spülmaschine gehalten hatte. Gustav freute sich sehr, als ich ihm in dem leeren Wohnzimmer Gesellschaft leistete, auch wenn es nur im Vorbeigehen war. Er war für jede Aufmerksamkeit dankbar. Ich wurde weich und konnte nicht anders, als ihn am Kopf zu streicheln.
Heute wollte ich auf ausgiebige Wanderungen verzichten, mich einfach in die Sonne packen und lesen. So machten es schließlich Tausende von Touristen. Nur noch schnell in den Laden laufen und etwas Proviant holen – ich kam mir im Apartment trotz des kameradschaftlich-liebesbedürftigen Gustavs fremd vor und hatte nicht gefrühstückt. Dass es schnell gehen würde, hatte ich angenommen, aber bei strahlendem Sonnenschein erwies sich das Hinaufgehen auf den Hausberg als tückisch – schon bald bremste ich ab, um nicht allzu sehr ins Schwitzen zu kommen. Wie war das nochmal? Zweimal rechts, dann wieder links und rechts? Hier sah alles gleich aus, überall die gleichen fremden Fassaden. An den Straßenschildern konnte ich mich nicht orientieren, denn die waren mit arabisch klingenden Namen beschriftet, die bei mir keinerlei Assoziationen auslösten. Daher hatte ich auch gar nicht versucht, mir den Straßennamen zu merken.
Kein Baum weit und breit, der als Orientierung hätte dienen können, kein Busch, kein Strauch, keine Hecke. – Kein Wunder, dass Cindy hier mit Gustav nicht Gassi ging. Irgendwie hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen, dass sie es tat. Ich stellte mich in einen Schattenfitzel, schmiss mein Navigationsprogramm an, ließ mich orten und gab Altania ein, den Namen des Ladens. Den zumindest hatte ich mir merken können.
Beim Busfahren hatte ich dazugelernt, ließ den ersten Bus hinaus aus Birkirkara unverrichteter Dinge davonsausen. Ich wollte im Schatten der Bushaltestelle abkühlen. Den zweiten würde ich nehmen, doch der mich offenbar nicht. Trotz ausgestreckter Hand, mit der man dem Busfahrer signalisierte, dass man einstiegsbereit sei, fuhr er an mir vorbei. War wahrscheinlich in ein Gespräch vertieft. Macht nichts, ich war ohnehin noch nicht komplett getrocknet.
Der nächste Bus hatte Erbarmen; der Fahrer ließ mich einsteigen, ich setzte meine Kapuze auf. Natürlich war es seltsam, bei dieser Hitze eine Kapuze aufzuhaben, aber ich hatte auch schon eine Frau gesehen, die sich einen Winterschal um ihren Hals gewickelt hatte. Attraktiv konnte ich später sein, zwar auch nicht außerhalb des Busses, wo mir die Klamotten am Leib klebten und das verdunstende Salz in den Stoff drang und ihn hell verfärbte, aber vielleicht ja am Abend.
Jetzt erst einmal unter den Sonnenschirm, den ich für 12 Euro ergattert hatte, und genießen. Ich zog ein Buch meiner Lieblingsautorin Juli Zeh heraus, das ich mir extra für den Urlaub aufgespart hatte, schaffte aber nur ein Kapitel. Irgendwie lief das mit dem Lesen zäh: Die Freundin des Helden hatte sich mit einer Pistole das Hirn rausgeblasen, Teile davon wareb überall verstreut. Die große Ananas, die ich am Stand ergattert hatte, und die mit Saft aus dem Supermarkt gefüllt war, schmeckte mir nicht so richtig. Ich sprang ins Wasser, aber auch da konnte man sich nicht ewig aufhalten, versuchte es mit noch einem Kapitel – und gab auf. Es half nichts; ich musste mich erneut auf Wanderung begeben. Hier mehr als zwei Stunden zuzubringen, war mir unmöglich, auch wenn ich den Schirm für den ganzen Tag gemietet hatte. So würde ich zumindest noch zwei weitere Buchten besichtigen können, die ganz in der Nähe waren.
Diesmal machte ich nicht denselben Fehler und kaufte mir vorab eine kleine Flasche Wasser. Google Maps schlug mir einen Weg vor, jeweils zwei Kilometer zu jeder Bucht, immer am Wasser entlang. Hörte sich gut an. Allerdings endete der Weg bald, führte geradewegs auf Klippen zu. Die konnte ich mir ansehen, klar, aber zurück musste ich wohl doch über die Hauptstraße. Wie gestern. Aber nein! Da führte ein schmaler Pfad hinunter in die nächste Bucht, verzweigte sich an einer Stelle, sodass ich weiterging und auf einem Felsareal zwischen zwei Buchten landete, das sich auch andere als Ausflugsziel auserkoren hatten. Dass es hier oben heiß war, brauche ich nicht zu erwähnen. Ich sah einen Läufer, der mit nacktem Oberkörper einen engen Pfad hinauflief. Beseelt von seiner Power folgte ich ihm, schaffte es aber nur bis zum nächsten Felsvorsprung, ehe ich etwas trinken musste. Ich wartete ab, bis er zurückkam und wollte von ihm wissen, ob der Weg an der Spitze des Berges weiterging. Er wusste es nicht.
Aber ein Weg hörte doch nicht einfach auf, bloß weil man die Spitze des Berges erreicht hatte! Ich kroch mühselig hinauf, sah nach. Und tatsächlich … bloß war es jetzt ein schmaler Pfad, der Platz für nur einen Fuß bot. Sollte ich es wagen? Was war die Alternative? Die ganze Strecke zurückzugehen bis zu dem Ort, wo ich meinen Schirm herrenlos zurückgelassen hatte?
Ich setzte meine Wanderung fort, unter mir der Abgrund. Kam an eine Stelle, an der es besonders eng war und besonders steil. Eine unachtsame Bewegung und ich würde die Klippen hinunterstürzten. Ich blickte zurück, sah den Weg, den ich bisher gegangen war, schaute nach unten auf die wenigen Menschen, die in der türkisfarbenen Bucht badeten – wer in Gottes Namen kam auf die Schnapsidee, diese Bucht aufzusuchen?! – und sagte zu mir: Du musst da jetzt durch.
Wagemutig stellte ich meinen Fuß auf. Und den nächsten. Ich hatte die erste Problemstelle gemeistert, doch die nächste kam recht bald. Hier war es nicht eng, dafür ging es steil nach unten. Ich beging eine Umweltsünde und ließ meine Plastikflasche zurück, denn in meinen kleinen Rucksack passte sie nicht – und hier brauchte ich jede Hand. Ich rutschte vorsichtig auf meinem Hinterteil nach unten.
Der Weg wurde wieder breiter, ich entdeckte einige Bäume und Sträucher und einen Stein im Schatten, auf dem ich mich niederließ. Dort sonderte ich eine Sprachnachricht an die Außenwelt ab. Ich lebte noch! Selbst die Zikaden verstummten ehrfürchtig. Von da an ging es nur noch bergab. Ich gelangte zur dritten Bucht, breitete mein Handtuch auf dem Sand aus, blieb liegen, in der prallen Sonne. Mir doch egal.
Den einstündigen Rückweg vom Strand verbrachte ich auf einem Bein direkt neben dem Busfahrer stehend, meine andere Seite flankierte ein kleiner Typ, der es nach zehn Minuten Fahrt in dem stickigen Gefährt aufgab, sich mit seinem Kumpel zu unterhalten. Ich hatte vorne eine prächtige Aussicht. Nicht einmal die Klimaanlage störte, bis hier kam sie nicht durch. Während ich beobachtete, dass der Busfahrer die winkenden Menschen am Straßenrand stehenließ, weil keine einzige Seele mehr in unsere große Blechdose passte, spürte ich, wie mir ein Schweißtropfen langsam den Rücken hinunterkullerte und wenig später die Kniekehle passierte. Hier konnte ich stundenlang stehen, mich an der Griffstange festhalten und das prächtige maltesische Panorama an mir vorbeiziehen lassen.

Keine Ecke war langweilig bei dieser Sightseeingtour der besonderen Art. Ich bewunderte den Busfahrer, der sein Fahrzeug geschickt durch die engen Straßen manövrierte. Sie hatten den Lauf der Zeit gut überstanden, hatten sich im Laufe der Jahre nicht verändern – und waren damit nicht auf den heutigen Verkehr vorbereitet. Wie schwierig war es allein, mit einem Panda hier durchzukommen. Von einem Bus ganz zu schweigen. Und wenn gerade ein zweiter entgegenkam, war es endgültig aus. Der Fahrer hupte an unübersichtlichen Stellen, um den Gegenverkehr zu warnen, hupte ständig. Kam den Berg kaum hoch, kroch langsam hinauf.
Wieder im Freien, beschloss ich, der Monte-Cristo-Stadt Mdina einen Besuch abzustatten. Jetzt, am Abend, konnte man es sich erlauben, durch die Gegend zu flanieren. Ich streifte durch die steinernen Gassen, zwischen kühlen Gemäuern, vorbei an uralten sandsteinfarbenen Fassaden, wäre gern in dieser imposanten, beruhigenden Stadt geblieben, bloß hatte man auf Malta nicht an die Nachtschwärmer gedacht. Der letzte Bus nach Valletta fuhr bereits am frühen Abend, und auch wenn mich Birkirkara nicht lockte, nahm ich ihn notgedrungen.
In Cindys Butze war eine kleine Party zugange; es war Freitag. Man saß auf der Terrasse. Gustav ließ sich nicht blicken, obwohl er mich sicher hatte hereinkommen hören. Heute hatte er das nicht nötig. Hinterlistiges Biest. Stattdessen sprang er in den eigens für ihn errichteten aufblasbaren Pool und genoss das Leben. Meins war aktuell ungenießbar, da ich das Terrassenfenster zuziehen musste, wenn ich den Zigarettenqualm der Partygäste nicht inhalieren wollte. Es schien nur Cindys „Boyfriend“ zu sein, doch weder er noch Cindy selbst sagten mir heute Hallo; die drei hatten sich offenbar gegen mich verschworen.
Immerhin machten sie nicht allzu lange, sodass ich die Terrassentür wieder öffnen konnte – was aber keine wirkliche Erleichterung brachte, da das Rollo davor klemmte. Ich wachte auf, weil sich auf meinem Kinn mehrere Schweißtropfen gebildet hatten, die stetig ins Bettlaken tropften. Nach der dritten Nacht war das Bettzeug nicht ganz so frisch, und mir stand noch so manche Nacht bevor. Auch bemerkte ich am Morgen, an dem ich wunderlicherweise nicht geweckt wurde – Cindy hatte heute frei –, dass es nach der Rückkehr aus der Küche in meinem Zimmer müffelte. Ich machte mich auf die Suche nach der Quelle des Gestanks, sah auf der Balkonterrasse einen Haufen, den Gustav dort hingesetzt hatte, doch das war es nicht. Da war noch etwas anderes, modriges. Ohne die Ursache gefunden zu haben, ging ich ins Bad, und erschrak zutiefst, als ich, auf dem Klo sitzend, ein lautes Krächzen vernahm. Der frühe Vogel leistete mir dort Gesellschaft, war in der Besenkammer untergebracht. Die feinen Herrschaften wollten wohl ausschlafen und hatten ihn dort deponiert.
Die beiden waren schon wach, als ich wieder in meinem Zimmer verschwand, Cindy schrubbte in professioneller Manier die Terrasse und seifte sie ein. In meinem Raum roch es immer noch und als ich meine Sachen für den anstehenden Ausflug zusammenpackte, war mir auch klar, warum. Mein Strandtuch hatte in der feuchten Schwüle des Zimmers keine Gelegenheit gehabt zu trocknen, das wurde ihm jetzt zunehmend zum Verhängnis. Ich packte es trotzdem in meinen Rucksack, wo es weiter vor sich hin faulen konnte. Unnötig zu erwähnen, dass ich Altania, den Laden, auch heute nicht auf Anhieb fand, sondern mich wieder verlief.
Auch nach drei weiteren Nächten besserte sich die Lage in meinem Zimmer nicht. Der Vogel schlief mal im Klo, mal nicht. Gustav war mal freundlich aufgelegt und ließ mich in Ruhe, mal war er auf Ärger aus. Immerhin hatte ich mich so weit diszipliniert, dass ich am frühen Abend ins Bett ging, um in aller Frühe, wenn er seine perfiden Türkratzangriffe auf mich startete, bereits topfit und ausgeschlafen zu sein. Das mit der erholsamen Nachtruhe war so eine Sache, weil mittlerweile das ganze Bettlaken klebte. Trotzdem freute ich mich immer auf den nächsten Tag, an dem es etwas zu entdecken gab. Seien es die inselbekannten Dingli Cliffs, an denen ich in sengender Hitze ohne Schatten eine halbe Stunde auf den Bus warten musste, oder die gelben Felsen von Sliema, wo mir abends ein erträglicher, ja, sogar schöner Spaziergang gelang. Ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, täglich 12 Euro für ein bisschen Schatten in Form eines Schirms und einer Liege zu zahlen, die ich regelmäßig nach zwei Stunden verließ, weil Juli Zehs Erstlingswerks nicht besser wurde, sodass ich es auf Seite 345 endgültig abbrach.
Selbst das Popeye Village, die Filmkulisse zum gleichnamigen Film, suchte ich auf. Es war ein entspannter Ort, an dem man es sich ohne Aufpreis auf einer Liege gemütlich machen konnte. Haddaway lief aus den Lautsprechern. Es wäre perfekt gewesen, wäre da nicht die Tatsache, dass alle Liegen bereits belegt waren. Einer von Popeys Helfern deutete meine suchende Miene richtig, fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Ja, sagte ich ratlos, ich hätte gern einen Liegeplatz. „No problem!“, gab der gute Mann von sich, stürmte voran. „Follow me“, hörte ich ihn nur noch sagen und wollte meinen Ohren kaum trauen. Sollte dies etwa ein perfekter Tag werden? Ich blieb ihm dicht auf den Fersen, als er sich zwischen diversen Liegen hindurchschlängelte, ausgelassenen Jugendlichen auswich und endlich freudestrahlend vor meiner Liege stehenblieb. Sie stand im Abseits, war überdacht – und gleich neben dem Klo. Über mehrere Reihen saßen dort Leute, die das Schicksal genauso schwer getroffen hatte, wie es jetzt mich treffen sollte.

Ich bedankte mich brav – und machte mich lieber auf den Weg in Richtung Blaue Lagune auf der Insel Comino. Camino war ein Paradies wie aus dem Bilderbuch. Eigentlich. Das Wasser, das man dort gelegentlich zwischen den hunderten von Körpern hindurchschimmern sah, war wirklich von einem bestechenden Türkis. Ich fand sogar einen Platz, gleich in der ersten Reihe, hüpfte hinunter ins Blau, schwamm der ganzen Horde, die im hüfthohen Wasser herumstand, davon, zum gegenüberliegenden Felsen. Und wo ich schon mal hier war, auch durch die dunkle Felsspalte, wo sich nur wenige hindurchtrauten. Während ich so vor mich hin schwamm, hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, was wohl passieren würde, wenn ich hier einen Krampf im Fuß bekäme. Wer mich hier aus der dunklen Tiefe herausziehen würde. Es war doch ein ganz schön weiter Weg. Sollte ich umkehren? Dann sah ich das Licht am Ende des Tunnels, steuerte darauf zu. Ich erreichte das offene Meer, die mich sogleich fortziehen wollten, hinaus aufs offene Meer. So hatte ich mir das auch nicht vorgestellt, drehte um und kehrte zurück in den wohligen Schoß der breiten Masse. Mein fauliges Handtuch ließ ich auf der Insel zurück. Das hatte ausgedient. Es war mein letzter Tag hier.
Hier geht es zu weiteren Reisesatiren:
Nackt in der großen Stadt
Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie?
Ich liebe Flöhe, Flöhe
Pipi in Paris
Ballaballamann

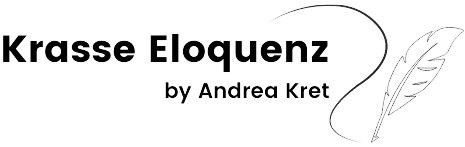



Pingback: Der Hund mit dem Winkepfötchen. Eine Flughafen-Story. – Krasse Eloquenz
Pingback: Näher am Äquator - Krasse Eloquenz
Pingback: Ballaballamann – Krasse Eloquenz
Pingback: Maßgeschneidert? Bloß nicht! – Die etwas andere Jobsuche – Krasse Eloquenz
Pingback: IT und Sprache? – Nein. Doch. Ahh! - Krasse Eloquenz