Nein, das Wort „kurwa“ gehört nicht zum Standardwortschatz des Polnischen, versuchte ich Dragan zu erklären, der eine gute Beobachtungsgabe hatte, findig war und sich der polnischen Sprache durch Nachahmung langsam bemächtigen wollte. Was lag da näher, als das kleine Wörtchen, das dort sehr verbreitet war und „Hure“ bedeutete, an jedes Satzende zu hängen, so, wie er es bei den eingefleischten, vorwiegend männlichen Polen beobachtet hatte. Wollte man es besonders stilecht halten, fügte man ganz simpel den Fugenlaut „y“ hinzu und unterschied sich von nun an kaum von einem Durchschnittspolen. Kur-y-wa! Diese kurvenreiche Begegnung mit der polnischen Sprache währte solange, wie ich dem Ganzen Einhalt gebot: „Das kannst du nicht sagen, Dragan. Lass das, Mensch.“
Es war ein etwas anderer Urlaub gewesen, in Oliwa, einem Stadtteil von Danzig. Wir wohnten in der kleinen Wohnung von Ola, bei der sich das Klo auf dem Innenhof befand, hatten den Pisswuffchen einen Besuch abgestattet – eine Hündin hatte Junge gekriegt, die in einem Schuppen umherwatschelten und in alle vier Ecken piescherten. Was noch? Dragan hatte versucht, sich am Würstchenstand einen Hot Dog zu bestellen, bloß kannten die Polen sowas damals nicht. Der Versuch endete damit, dass der gutmütige Standbesitzer die zischende Krakauer einmal quer und einmal längs durchschnitt, die Wurstviertel in ein Brötchen packte und das Ganze zufrieden Dragan überreichte. So hatte der das nicht gemeint – aber der gute Wille zählte.
Mit den Nachbarn von nebenan feierten wir die Anschaffung einer neuen Türklinke. Jeder Anlass war doch gut genug, Alkohol in Strömen fließen zu lassen. Man erzählte Dragan voller Stolz, dass man hier in Polen ebenfalls Staus hätte. Irgendjemand tanzte Bolero.
Irgendwann, irgendwann war alles ausgereizt; es musste weitergehen. Und zwar ins ehemalige Jugoslawien, beschlossen wir. Mit nicht ganz 800 Mark in der Tasche. Kurz nach Erreichen der Volljährigkeit stellte das kein allzu großes Problem dar.
„Wie – Jugoslawien, einfach so? Spinnst du?“ Ola war da ganz undiplomatisch, als ich ihr den Vorschlag unterbreitete, mit uns in die Heimat von Dragan zu kommen.
Als sie am folgenden Tag mit mehr Fingerspitzengefühl versuchte, ihr Ein und Alles, den treuen Pawlik, davon zu überzeugen, dass sie wegwolle, gings dann doch nicht ganz ohne Missstimmung: „Ein wenig Freiheit will ich auch mal haben. Stell dich nicht an!“ Sie versprach, täglich anzurufen.
Das war nicht nötig, denn jeden Tag, gleich nachdem wir unser Handy eingeschaltet hatten, meldete sich das Gerät mit einer SMS an Ola. Das eigene Mobiltelefon hatte zu der Zeit – wir waren im Jahr vor dem großen Millennium – Polen noch nicht wirklich erreicht. Eine Stunde später klingelte es und eine weinerliche Stimme wollte die Freundin sprechen.
„Ja, aber ich hab dich doch ganz doll lieb, Pawlik. Sag nicht solche Sachen“, hörten wir Ola ins Handy schreien. Die Verbindung war nicht gut, der Anruf hatte uns in der Walachei erwischt, irgendwo auf der Strecke zwischen Ostsee und Warschau. Dort mussten wir hin, weil Ola als Polin ein Visum für Serbien benötigte. Eine Kleinigkeit. Deutlich schwieriger war es, in Warschau einen Gratisschlafplatz zu finden; kein Feldweg weit und breit, in dem man sein Auto zum Übernachten abstellen konnte. Eine hilfsbereite, dem Konsum von bewusstseinserweiternden Substanzen nicht abgeneigte Polin Mitte zwanzig, die wir bei McDonald’s trafen, bot uns an, ihr zu folgen. Sie hätte da einen Raum. Der sich mittels eines Riegels sogar so gut wie abschließen ließ. Der Raum sei nett, es lägen nur einige Spritzen herum. Wir zögerten, bedankten uns für das super Angebot und kreisten in den nächsten beiden Stunden durch die Innenstadt auf der Suche nach dem perfekten Parkplatz. Je später der Abend, desto niedriger wurden unsere Ansprüche; schließlich fanden wir unter Bäumen eine geräumige Stellfläche, mit der wir uns zufriedengaben. Schon bald waren wir im Land der Träume, Dragan mitsamt Yogamatte auf dem Kopfsteinpflaster neben dem Auto, ich auf dem Beifahrersitz, Ola und der Hund hinten auf der Rückbank des 190er Mercedes.
Die Sonne ist Spontanreisenden gegenüber unerbittlich und scheint ihnen in aller Frühe ins Gesicht, egal wann sie sich auf dem Beifahrersitz langgemacht haben. Ein neuer, verheißungsvoller Tag brach an, vorsichtig öffnete ich meine Augen – und erblickte zwei Schlipsträger, die an unserem Wagen vorbeieilten. Ich rieb mir die Augen, schob es auf die anstrengende Nacht, doch die Schlipsträger waren nach wie vor da, wenn auch weiter weg. Da hinten rechts, da waren ebenfalls welche. Diesmal in Begleitung einer schlanken Blondine im Kostüm. Ich rollte mich rüber auf den anderen Sitz, öffnete die Fahrertür, schaute zu Dragan hinunter, der quer auf der Yogamatte lag, setzte an: „Hey …“ – und sah das mächtige Gebäude. Ach du heilige …
„Dragan, Dragan, komm schnell rein. Du liegst auf dem Parkplatz des polnischen Parlaments“, rief ich ihm zu, während ein Krawattenmensch, von hinten kommend, fast über ihn gestolpert wäre. Professionell, wie er war, ließ er sich nichts anmerken und setzte seinen Weg eilenden Schrittes fort. Auch Ola wurde langsam munter, strich sich durch ihre strubbeligen Haare. Nach einer Weile hatte ich die beiden von der Peinlichkeit der Lage überzeugt, Dragan räkelte sich, sah einen Polizeiwagen herannahen, legte sich geistesgegenwärtig wieder hin und tat so, als wenn er an dem Wagen herumschrauben würde. Bis die Luft rein war. Der Hund hatte das Nachsehen. Wir ließen ihn nicht zum Gassigehen raus, sondern machten die Biege. In sicherer Entfernung, nach mindestens fünfzehn Minuten Fahrt, durfte das Tier in einem Park raus und das mit Olas Visum erledigten wir im Anschluss. Fast hätten die serbischen Beamten Schwierigkeiten gemacht, als sie hörten, dass Dragan und ich Deutsch miteinander sprachen. Doch der gab sein eingerostetes Serbisch zum Besten und schaffte es tatsächlich, dass wir das Visum am selben Tag bekamen. Die Frage, was eine Deutsche, ich, hier in Polen suchte, ließ er unbeantwortet.

Auf dem Weg nach Krakau bereiteten wir Ola mit viel Fingerspitzengefühl auf unser Ziel vor: „In Jugoslawien, da baden die Leute in Kübeln. Nur dass du dich nicht wunderst. Kühlschränke kennt man da nicht. Man kühlt die Lebensmittel im Fluss. Ach ja, das Klo ist 500 Meter entfernt, draußen.“ Ola erwiderte, sie sei hart im Nehmen und freute sich auf die nächste Station. Krakau, was einfach nur alt, schön und deshalb kaum erwähnenswert ist. Interessanter war da die Polizeiwagenattrappe aus Pappe, die wir unterwegs passierten und die Autofahrer daran erinnern sollte, dass es sich lohnte, langsam zu fahren. Bei uns wirkte sie definitiv: Wir verlangsamten, hielten an und machten als Andenken jeder ein Bild mit dem blauen Pappauto.
Richtig interessant wurde es an der tschechischen Grenze, als Ola einen Heulkrampf bekam. Es lag nicht daran, dass wir langsam an einem Fahrzeug mit ihren Landsleuten vorbeifuhren, das unter Zuhilfenahme eines Gürtels ein anderes abschleppte. Ganz vorsichtig gingen sie dabei vor. Ob der Gürtel riss, ist nicht verbürgt. Mag sein, dass unser Hund Mephisto der Grund für Olas Weinen war, da er sich zu sehr auf ihrer Seite breitgemacht hatte, mag sein, dass es durch den Schlafentzug kam. Oder einfach weil sie keine Schokovorräte mehr hatte. Die Heulerei ging über auf mich. Ich weiß nicht mehr, warum ich weinte. Vielleicht weil die Perspektive, die kommende Nacht erneut im Auto zu verbringen, nicht allzu verlockend schien, vielleicht weil wir das malerische Krakau verlassen hatten, vielleicht nur zur Gesellschaft, um Ola in dieser offenbar schweren Stunde beizustehen. Dragan verlor die Nerven, stieß ein „Herrgott nochmal!“ aus – was ich für Ola dolmetschen musste. Ihre Antwort darauf, in der Pawlik vorkam, dolmetschte ich wiederum für ihn; die Situation wurde zu einer absurden: Tränen wandelten sich in Freudentränen, die wir mit unseren nicht mehr ganz sauberen Händen aus dem Gesicht wischten. Wir freuten uns, dass wir im wunderbaren Tschechien waren, und Ola kurbelte auf das Geheiß des Grenzsoldaten folgsam die Scheibe herunter, die durch Mephistos Speichel derart verschmutzt war, dass man nicht hindurchsehen konnte.
Für die Beschreibung der Goldenen Stadt, die wir am nächsten Tag aufsuchten, empfehle ich einschlägige Reiseführer. Hier war man nett und zivil und bot mir keinen Schreibstoff. Auch die Bewohner der Stadt waren eher enttäuscht von uns, als wir in einem Restaurant 1 Pfennig Trinkgeld gaben, weil wir mit der Währung nicht vertraut waren. In schriftstellerischer Hinsicht spannend wurde es erst wieder dank meiner Intervention; als ich Dragan dazu nötigte, auf dem Weg zum sicher malerischen serbischen Dorf Vukovac, dem Ziel unserer Reise, die Hauptstädte, die auf dem Weg lagen, mitzunehmen. Im Gegenzug würde ich den restlichen Sommer nicht mehr versuchen, ihm vom Rauchen abzuhalten. Ein durchaus fairer Deal, wie ich fand. Dragan zündete sich eine an. Die Hauptstädte auf dem Weg also. Und das waren so einige.
Den Beamten an der tschechisch-österreichischen Grenze mussten wir aufwecken, weil hier über Landstraße selten einer entlangfuhr. Freundlich ließ er uns durch. Auf der anderen Seite herrschte Recht und Ordnung. Prompt wurde Dragan hier gefragt, wozu Scheinwerfer da seien. Ob er sich die Frage jemals gestellt hätte.
„Zum Leuchten“, erwiderte der pflichtgemäß.
„Na bitte!“, sagte der Grenzer und zeigte auf unsere Scheinwerfer, die kaum noch Licht durchließen, so schmutzig waren sie.
Wir erreichten die graue Monumentstadt. Ich weiß, einige von Ihnen werden aufschreien: „Aber Wien ist doch schön. Und gar nicht so tot.“ Sie werden vermutlich Recht haben; das Problem war: Dragan hatte Hunger. Wir kreisten von Monument zu Monument und hielten Ausschau nach einem Discounter oder meinetwegen einer billigen Würstchenbude, doch die waren den Österreichern zu profan. Friss das echte Wiener Schnitzel mit einem Durchmesser von einem Meter oder stirb. Klar, satt geworden wären Ola, Dragan, ich und Mephisto davon allemal, bloß rentierte sich die Investition selbst bei den dreieinhalb Personen nicht. Vom Preis des Schnitzels ließe sich mühelos eine fünfköpfige Familie eine Woche lang durchfüttern. Dragans Laune verhielt sich umgekehrt proportional zur Menge der bereits gesichteten Monumente. Dazu nieselte es. Mein Versuch, die Lage zu entschärfen, endete mit einem bösen Blick und einem durchaus nicht zu verharmlosenden Schimpfwort, das aus seinem Mund kam und das ich an dieser Stelle nicht wiedergeben möchte. Von nun an verhielten wir uns still und waren froh, dass es uns nicht traf, bis bei Subway – dass wir das noch erleben durften! – ein Baguette den Weg Dragans Schlund hinabfand.
Mit vollem Magen besserte sich seine Laune etwas, trotzdem verließen wir die düstere Stadt sogleich – das Grau der Gebäude, die grauen Wolken, die grauen Menschen machten uns depressiv. In dieser Lage hülfe nur ein Fiaker, ein Kaffee mit Rum, aber wir waren ja in einem Pkw unterwegs. Es wurde auch nicht besser, als wir auf dem überteuerten Prater eine witzige Attraktion entdecken: Barhocker mit Stuhlbeinen, die Krampfadern hatten. Hier war wirklich nichts mehr zu holen.
Wie anders dagegen war es in der Slowakei. Der Polizist, der uns direkt bei der Einfahrt nach Bratislava anhielt, wies uns höflich darauf hin, dass unser Rücklicht nicht ging, und wünschte uns noch eine gute Fahrt. Die nächste Polizeistreife war hilfsbereit und verständnisvoll, als ich erklärte, wir seien eben schon wegen der Lampe angehalten worden: Man winkte uns beim Wegfahren hinterher. Bei der dritten Kontrolle, die uns aus dem Verkehr zog – eins unserer Rücklichter war nämlich kaputt – bedankten wir uns für den Hinweis und Dragan schwor beim Leben seiner Mutter, dass wir das Malheur gleich am nächsten Tag in Ordnung bringen würden. Die Gelegenheit war günstig: Er fragte den Polizisten nach einem günstigen Hotel. Ich merke mir das mit dem Schwören auf die Mutter, falls ich mal in eine ähnliche Situation kommen sollte; wir wurden fortan nicht weiter behelligt, sondern standen um Mitternacht vor einem Hochhaushotel, von dem wir uns Regeneration verhofften. Wir waren wirklich fertig.
Man bot uns drei zerzausten, unrasierten und ungewaschenen Gestalten freundlich zwei Zweierzimmer an, doch wir schüttelten vehement den Kopf und bestanden auf ein Dreierzimmer, das wir uns eher leisten konnten. Ja, auch das hätte man, bestätigte der Rezeptionist und zwinkerte uns neckisch zu, bevor wir zu dritt in Richtung Zimmer 208 verschwanden. Ola beschloss, dass heute ein Feiertag sei und sie sich deshalb nicht die Zähne putzen müsse. Aus reiner Gewohnheit nahm sie Mephisto mit ins Bett. Nach jahrelangem Aufenthalt im Land der Ordnung hatte ich mehr Disziplin, zog die Sache mit dem Zähneputzen durch und fiel gegen 1 Uhr halbtot ins Bett.
Die Nachtruhe war intensiv, aber kurz. Um 7 Uhr morgens entschloss sich ein Pressbohrhammer, uns unsanft in die Realität zurückzuholen. Schlaftrunken setzten wir uns auf, hielten uns die Ohren zu. Verärgert lief Ola hinaus, um die Bauarbeiter zusammenstauchen, bis ihr einfiel, dass sie die hiesige Sprache gar nicht beherrschte. Was blieb uns übrig, als wach zu werden und das Weite zu suchen – noch bevor sich die Aggression des Presslufthammers auf uns übertragen konnte und es zu einem Tötungsdelikt im Affekt kam. Dass ich bei der Schlüsselabgabe den Portier nicht erwürgte, war Dragan zu verdanken, der mir Nocken versprach, die slowakische Spezialität. Mit Teigwaren, Knödeln, Nocken konnte man mich kriegen: Die Welt war wieder in Ordnung, als drei Schüsseln Brimsennocken vor uns standen und eine vierte aus Blech unten für den Hund. Ich rechnete den Preis für die Nocken um in Wiener Schnitzel, die echten, doch so etwas ließ sich nicht berechnen. Wir aßen schweigend, mit dem guten Gefühl, nur einen Bruchteil des Wienerschnitzelpreises ausgegeben zu haben.
Voller Wehmut verließen wir die Stadt, die nur einige zweitklassige Denkmäler hatte, dafür aber so lebendig war, dass sich Wien eine Schnitzelscheibe davon abschneiden konnte. Es leben die slowakischen Brimsennocken!
Budapest. Die Stadt lockte schon von Weitem. Überall Schilder, die darauf verwiesen. Alle Wege führten eben nicht ausschließlich nach Rom. Das Ding war: Wir wollten weder nach Rom noch nach Budapest, hatten uns spontan entschieden, einen Abstecher zum Balatonsee zu machen. Und ausgerechnet der war nicht ausgeschildert. Wir verloren uns irgendwo auf langen Waldstraßen, blieben stehen, als wir in einem Dorf einen betagten Mann seines Weges gehen sahen. Was folgte, lässt sich eher pantomimisch darstellen denn beschreiben. Sein Blick hellte sich beim Wort „Balaton“ schlagartig auf, er beschrieb uns den Weg dorthin. Dachte er zumindest. Er malte mit seiner rechten Hand einen Hügel nach, es folgten schnelle, kurze Haken, einer rechts, zwei links, auf und ab. Sogar die linke Hand musste er zur Hilfe nehmen. Ich sah Schlaglöcher vor meinem inneren Auge, Todeskurven, stolze Erhebungen. Schließlich sagte er „Tschu, tschu, tschu“, machte Schlangenlinien dabei. Dragan lachte: „Ah! Tschu, tschu, tschu.“ Amüsiert und nach wie vor orientierungslos fuhren wir weiter nach Gefühl, aus dem uns Pawlik mit seinem täglichen Anruf riss. Er könne so nicht weiterleben. So ganz ohne Ola. Wieso sie ihm das antäte – hörte ich ihn durch das Handy brüllen; inzwischen machten wir uns nicht mehr die Mühe auszusteigen und Ola das bisschen Privatsphäre zu gönnen. Reisen auf engstem Raum schweißt zusammen. Wir fühlten uns wie die vier Panzersoldaten mit Hund, die Helden einer bekannten polnischen Kriegs-Soap. Zu der Zeit ahnten wir noch nicht, dass uns Pawliks Fürsorge einen Hunderter kosten würde. Den bekamen wir in Form der Handyrechnung im darauffolgenden Monat präsentiert. Ja, wie konnte ein ahnungsloser Anrufer auch – Pawlik mal ausgenommen – ahnen, dass wir uns gerade in den Wirren der ungarischen Landschaft befanden oder von mir aus bei den Pygmäen in Gabun, und wieso sollte er für seine Ahnungslosigkeit bitter, in Form von Cash, bezahlen? Wenn man die Differenz doch dem Angerufenen aufs Auge drücken konnte. Der wusste immerhin, wo er war, uns mal ausgenommen – und wenn er sich auf solch zwielichtige Anrufe wie den von Pawlik einließ, wurde er halt zur Kasse gebeten. Olas Mutter trug viel weniger Schuld an der hohen Handyrechnung – sie rief nur zweimal an, um nach dem Rechten zu fragen, kam laut Rechnung auf insgesamt 2 : 38 Minuten.
Am späten Nachmittag gelang es uns tatsächlich, den Balatonsee zu erreichen. Wir hatten die Wahl, unsere Basis in einer der balatonnahen Ortschaften, Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonfüzfö, Balatonkenese oder Siófok, zu errichten, steuerten einen Campingplatz nahe Zamárdi an, duschten dort illegal, saßen frisch gewaschen auf einer Bank vor dem Gelände und besprachen das Vorgehen. Den Luxus einer weiteren Übernachtung konnten wir uns nicht leisten, sonst wäre Budapest die Endstation gewesen, mit der unerfüllten Sehnsucht nach Vukovac. Da schickte uns der Himmel einen Engel. Einen Engel auf einem Mokick, dessen Auspuff am Boden schleifte, einen Engel mit zerfurchtem, sonnengebräuntem Gesicht und altem Pilotenhelm. Der Alte bot uns eine total billige Unterkunft an, ein Häuschen mit Garten, er versprach uns den Garten Eden, versprach ihn uns teilweise auf Deutsch – irgendetwas hielt uns zurück. Wir wählten den schwierigen, jedoch erfüllenden Weg, kreisten in der Nacht stundenlang über die Felder auf der Suche nach einem abgelegenen Winkel, begegneten Prostituierten, die am Feldrand auf Kundschaft warteten, fanden einen guten Platz und legten uns draußen zu zweit in unser Schlauchboot, das Dragan extra für diese Gelegenheit aufgepumpt hatte, Ola auf ihre Yogamatte, der Hund ins Maisfeld. Wir sahen hinauf zu den Sternen, redeten, grunzten. Moment mal, wieso grunzen? Wer grunzte denn da in die Nacht hinein? Dragan, erfahrener Möchtegern-Veteran, kam hoch, lauschte, erkannte ein Wildschwein.
„Ein Wildschwein, ja?“, sagte ich unwillig. „Das ist ja jetzt nicht optimal. Müssen wir uns Sorgen machen?“
Als Dragan bejahte und mir etwas von wilden Tieren und ihrem Revier und den in der Ferne leuchtenden Augen des Wildschweins erzählte, ich das leise Schnaufen und das Stampfen des Tiers hörte, bekam ich es mit der Angst zu tun, stand auf und sah nur, wie jemand im Auto verschwand. In solchen Situationen stellt sich heraus, wer ein Mann ist und wer nicht. Mephisto war keiner. Und das nicht nur, weil es ein Weibchen war. Der Feigling brachte Schande über seinen Namen, indem ihn seine hündische Intuition alsbald ins Auto getrieben hatte. Ola und ich folgten dem Hund, Dragan verweilte noch ein wenig, nicht zu lange, halbwegs lässig vor dem Wagen. Die Türen wurden geschlossen, Ola hängte Handtücher ins Fenster als Ersatz für Gardinen und wir verbrachten erneut eine Nacht in der Blechdose. Im eigenen Saft, denn das Duschen am Abend hatte sich nicht gelohnt; wir schwitzten schon nach einer Stunde nach, hätten es gleich lassen können. Zu diesem Schluss waren manche Bewohner dieses Landes ebenfalls gekommen, wie wir zu einem späteren Zeitpunkt bei einer Fahrt in der Bahn feststellen mussten. Aber noch steckten wir im Auto.
Der Balatonsee war zwar schön, es roch zwar nach Natur, man konnte zwar kilometerweit hindurchwaten, es war zwar eine tolle Abkühlung und beim Eismann hatten sie exotische Sorten. Doch irgendwie waren ein paar Deutsche zu viel auf den Geschmack gekommen. Sie waren rechts, sie waren links, überall. Es gab kein Entkommen. Stattdessen gabs Pommes, es gab Bratwurst und ich schaute um mich, ob ich eimersaufende Spätpubertierer entdecken würde. Wie gern hätte ich mich an der unergründlichen ungarischen Sprache versucht! Welch Lust hätte ich verspürt, eine Speisekarte vorgelegt zu bekommen, auf der ich nicht einmal Bahnhof verstand, auf der sich einfach bei geschlossenen Augen mein Finger auf einem der kryptischen langen Namen niederlassen musste – und dann stünde wenige Augenblicke später ein verdächtig aussehendes, aber dennoch schmackhaftes Gericht vor mir. Ich wär noch viel gewiefter gewesen und hätte anderen Leuten auf die Teller geguckt, um das Beste auszuwählen und es anschließend per Zeigefinger, den ich diskret auf den fremden Teller gerichtet hätte, zu bestellen. Das entging uns nun alles und wir mussten hungern, denn auf Bratwurst und Pommes wollten wir uns aus Prinzip nicht einlassen. Und die Speisekarte verstanden wir erst recht. Wir wollten auch keinen „Hupschrauber Flug“ über den See buchen, nein. Einen Penny betraten wir dann doch in der Hoffnung, unseren Frust etwas abzumildern. Ola mit einer Flasche Martini d’Oro, Dragan ganz klassisch mit Holsten, ich extravagant mit Bacardi Breezer. Dies alles schmuggelten wir in eine kleine Dorfdisco in Szántód, wo wir uns unumwunden besaufen wollten. Die Spottpreise vor Ort wollten wir nicht zahlen – wir reichen Leut mit deutschen Kennzeichen! Die Disco entschädigte uns für alle bisherigen Enttäuschungen: Das Klo war verstopft und ließ sich nicht verriegeln, die Musik war mittelmäßig, ich klebte mit meinem Outfit leicht am Stuhl, doch dank der langen schwarzen Satinhandschuhe backte sonst nichts an. Kurz: Wir hatten unseren Spaß. Nach dem fünften Getränk bekamen wir nicht mehr viel mit. Die Bedienung hingegen mehr, als uns lieb war: Nachdem sie mehrmals leere Flaschen abgeräumt hatte, die es in dem Schuppen gar nicht gab, wurde sie stutzig. Trotz Pseudobestellung einiger Getränke vor Ort flogen wir auf: Man fackelte nicht lange, schmiss uns raus. Immerhin mussten wir diesmal nicht umherkreisen auf der Suche nach einem Parkplatz. Für das Kreisen in unseren Köpfen hatte der „Allohol“ gesorgt und wir schmissen uns ganz unzeremoniell zum Hund ins Auto, Dragan pennte wie so oft vor dem Wagen auf der Yogamatte und ob uns andere heimkehrenden Discobesucher scheel von der Seite anschauten, war uns endlich mal piepegal. Trotz des geschützten Schlafplatzes wurde Ola von den Mücken ausgesaugt, nicht Dragan. Der hatte einfach mehr getankt und suhlte sich bei Tagesanbruch in seinem weißen Ausgehhemd auf dem Boden, fernab seiner Matte.

Es war Zeit, weiterzuziehen. Leichter gesagt als getan, war doch der Weg über Landstraße nach Budapest nicht ausgeschildert, damit man Autobahn fuhr. Und Maut bezahlte. Wie zuvor behalfen wir uns mit Fragen, bekamen zur Antwort mit den Händen angedeutete Schlangenlinien, kamen weiter, überholten einen alten Mann auf einem rostigen Fahrrad. Doch da! Wir wurden geblitzt. Das durfte nicht wahr sein. In einem fremden Land geblitzt zu werden, weil man zu schnell fuhr – das würde teuer werden. Vielleicht ließe man uns sogar nicht über die Grenze oder kassierte uns dort ab. Beunruhigt übte ich Druck auf Dragan aus, damit er umkehrte und wir den Blitzer inspizieren konnten. Wir kamen dem alten Fahrradfahrer entgegen, drehten, als wir weit genug gefahren waren, wieder um, um frontal auf den Apparat zuzufahren. Nix. Ich hatte keine Ruhe. Schon waren wir wieder am Drehen, pirschten uns diesmal ganz langsam vor. Der alte Mann wieder vor uns. In Zeitlupe fuhren wir an ihm vorbei, schauten nach links, wo der Blitzer war. Ich sah über den Schminkspiegel nach hinten: Der Fahrradfahrer war weg! Einfach verschwunden. Obwohl rechts und links keine Häuser standen, keine Straßen waren.
„Der ist mitsamt Fahrrad in den Graben gefallen. Herzinfarkt“, meinte Ola. „Dachte, er würde von einer Bande Deutscher ausgeraubt werden.“
„Oder er hat so schnell in die Pedale getreten, dass er Lichtgeschwindigkeit erreicht hat und an einen anderen Ort gebeamt wurde.“
Auch wenn es uns um den Fahrradfahrer leidtat, waren wir umso erleichterter, als wir schließlich eine Madonna in einem Glaskasten entdeckten. Sie war es, die uns geblitzt hatte. Es war wie ein Zeichen – nur wofür?
In Budapest erinnere ich mich an Schnittchen, Schnittchen, Schnittchen, die waren so klein, so bunt, so günstig. Wir veranstalteten ein Schnittchengelage und präferierten alle die Lachsvariante. Nur der Hund fand die mit Schinken besser. Bis zum Ende des Tages wollten wir uns per U-Bahn fortbewegen; das versprach etwas Abkühlung an diesem Tag, an dem man sogar um die Fußknöchel herum schwitzte. Endlich verstanden wir wieder nichts – und man uns nicht. Wir wollten Fahrkarten kaufen. Diese Herausforderung meisterten wir mit Bravour. Ich zeigte dem Mann im Kassenhäuschen den Punkt auf dem Plan der U-Bahn: Da! Da genau wollten wir hin. Und wir waren drei. Drei meiner Finger gingen in die Höhe. Zur Sicherheit deutete ich auf Dragan, Ola und zuletzt auf mich. Sehr zufrieden war ich mit mir, als der Häuschenmann uns drei Karten aushändigte. Die zeigten wir der Kontrolleurin, die am Ausgang der Zielstation stand, doch zufrieden war die nicht, schüttelte kategorisch den Kopf. Den ungarischen Wortschwall hätte sie sich zwar sparen können; wir verstanden dennoch, dass sie meinte, unsere Fahrkarten wären ungültig. Erkläre nun einer solchen Dame, dass du die Karte vorschriftsmäßig beim Fahrkartenhäuschenmann einige Stationen vorher gelöst hast. Hier waren Mimikkenntnisse gefragt; Ola sprang ein: Sie schaute sehr bestimmt. „Wir haben Recht, du nicht“, sagte ihr Blick. Weit kam sie damit nicht, also übernahm Dragan und wollte wissen, wie viel die Fahrkartenschrulle haben wollte. 10 Mark pro Person. Eigentlich spottbillig. Aber für das Geld hätten wir im Laden von vorhin einen weiteren Schnittchenvormittag veranstalten können. Für die Umrechnung in Wiener Schnitzel hatte ich jetzt keine Nerven. Wir hatten keine Wahl, ärgerten uns schwarz, drückten die Kohle ab. Auch beim abendlichen Restaurantbesuch sorgte man dafür, dass wir hiernach – im Gegensatz zu Prag – einige berichtenswerte Erlebnisse vorweisen konnten. Man haute uns nach höchster Kunst übers Ohr: Jeder von uns hatte ein Gericht und ein Getränk bestellt. Auf der Rechnung, die uns der Kellner sogar deutschsprechender Weise überreichte, waren erstaunlicherweise acht Positionen aufgeführt. Nun finde heraus, wofür die zusätzlichen zwei Posten standen. So weit reichte das Deutsch des Kellners dann doch nicht. Wir zahlten die Zeche und verließen die Stadt – hier hatten wir genug gesehen.

Endlich in Serbien! Endlich passierte was, als uns ein Lastwagenfahrer bei nahendem Gegenverkehr todesmutig überholte und dabei eine volle Plastikflasche auf unsere Frontscheibe schmiss. So kurz nach dem Balkankrieg konnte man nicht von Innigkeit bei dem Verhältnis von Serben und Deutschen sprechen. Wir wollten ihm erklären, dass wir gar nicht so deutsch waren, wie er dachte – Dragan hatte zwar einen deutschen Vater, aber eine serbische Mutter, ich hatte weder einen deutschen Vater noch eine deutsche Mutter, dafür einen deutschen Pass – vielleicht reichte das ins seinen Augen schon? Und Ola? Die war ganz unschuldig, weil ganz polnisch. Doch der Lkw-Fahrer war bereits mit schwarz qualmendem Auspuff an uns vorbeigefahren.
„Außer den Russen, Griechen und Franzosen werden hier keine Völker toleriert“, bemerkte Dragan und fuhr, als er unsere fragende Miene sah, fort. „Die Rumänen sind Penner, Zigeuner und Lohnarbeiter. Die Polen Verräter, da in der NATO. Ungarn: Diebe und Zigeuner. Die Engländer zu fein. Die Deutschen Nazis und die Amerikaner seit dem Krieg Todfeinde. Die Holländer sind Spinner und Drogenjunkies, die Österreicher eine Mischung aus Deutschen und Engländern. Die Schweizer sind geizig und haben einen Ordnungstick. Ja, und die Italiener keine richtigen Männer, Schmalzbacken. Und außerdem ist hier in Serbien jeder Oberkommandant“, beendete Dragan seine Ausführungen.

In Belgrad, wo wir mit unserer EC-Karte die restlichen Piepen vom Konto abheben wollten, lachte man uns aus und erzählte Dragan was von der Jugo Card. Die EC-Karte könne er sich an den Hut stecken. Das tat er auch für die Zeit seines Aufenthalts in diesem Land. Sah lustig aus.
Dafür empfing man uns im Dorf herzlich. Die beiden Truthähne reckten ihren Hals, stießen seltsame Laute aus. Dragans Oma nuschelte etwas, drückte uns ganz fest an ihre Brust, gab uns einen schmatzenden Kuss auf die Wange. Nein, man kann nicht sagen, dass ihr Atem nach Knoblauch roch. Vielmehr dünstete sie den Knoblauch durch jede Pore aus. Die Tante roch ebenfalls nach Knobi, die rumänischen Gastarbeiter auch, sogar der Hund hatte neben Flöhen eine Knoblauchfahne. Die Oma schloss uns gleich ins Herz – und zwar genau bis zum nächsten Morgen. An dem wir bis 12 Uhr ausschliefen und sie Dragan fragte, wo die Mädchen geblieben seien. Er selbst konnte es sich nicht leisten, vor seiner Großmutter als schludrig dazustehen, und so stand er um 7 Uhr auf der Matte und wurde von der Oma gleich auf den Trecker abkommandiert. Wir brauchten unseren Schlaf, außerdem pfiffen wir auf irgendwelche Trecker. Einen überteuerten Urlaub auf dem Bauernhof hatten wir ja nicht gebucht. Wir schliefen in dem schönen, neu erbauten Haus von Dragans Familie, das selbstverständlich an die Kanalisation angeschlossen und mit Badewanne und handelsüblichem Kühlschrank ausgestattet war – Ola hatten wir aus Spaß Blödsinn erzählt. Auf Fußbodenschrubben, das die Oma uns ans Herz legen wollte, standen wir ebenso wenig und ließen das von Dragan so übersetzen, als er vorbeikam, deshalb fragte die Oma am darauffolgenden Morgen um 13 Uhr nicht mehr nach den Mädchen, sondern nach den „pizdurine“. Wie erkläre ich jetzt den Ausdruck …? Die deutsche Sprache ist bei sowas ja so arm. Stellen Sie sich einfach ein nicht ganz schmeichelhaftes Wort für das weibliche Geschlechtsteil vor, das Ganze derb abwertend, schon haben Sie es in etwa. Mit derartigen Ausdrücken wurden die slawischen Sprachen reich beschenkt, und die Alte genoss es, gerade dieses Wort aus ihrem Repertoire zu graben.

Noch mehr Hass auf uns als die Oma hatten die einheimischen Flöhe. Im Vorbeilaufen – er wurde gerade in den Stall geschickt – rief uns Dragan zu, dass im Schuppen eine Chemikalienflasche stünde, mit der man das ganze Haus besprühen müsse. Dann kämen sie nicht mehr, die Flöhe. Wir besprühten statt des Hauses einfach unsere Röcke und hatten Ruhe, während Dragan mit den Flöhen der Schweine vorliebnahm und damit schon am Abend gute Ergebnisse erzielte. Völlig erledigt und zerstochen saß er am Tisch, aß Spanferkel, ließ es sich dennoch nicht nehmen, anzukündigen, dass wir bald eine Disco aufsuchen würden. Eine echte serbische. Um Sprit zu sparen, fuhren wir mit ausgeschaltetem Motor hinunter ins Tal. Die Disco bot eine willkommene Abwechslung im dörflichen Treckerallerlei, wenn es auch recht wenige Sitzplätze gab.
„Ich habe noch nie einen Kellner in Jogginghose gesehen“, entfuhr es Ola.
Die Jugend stand etwas blöd in der Gegend herum, doch schon bald taten Kruškovac, Sliwowitz und Co. ihre Wirkung und es kam zum aktiven Teil des Abends: zum Tanzen. Ich war sehr erfreut über die Liederauswahl, die anders ausfiel als bei uns zu Hause. In den Liedern, die Dragan dort meist in einer Endlosschleife laufen ließ, war von einer Rose die Rede. Oder einem Kumpan. So genau konnte ich das nicht verstehen, beides hörte sich auf Serbokroatisch ähnlich an, vor allem weil der Sänger den Text leiernd vortrug. Auf jeden Fall hatte es mit jener Rose/jenem Kumpan eine leidvolle Geschichte auf sich, die es abzusingen galt. Da wurde selbst dem, der nichts bis wenig verstand, ganz melancholisch zumute. Man wünschte sich einen Strick herbei, damit dieses Lied bloß aufhörte.
Nein, so oldschool war man in dieser Disse nicht, im Gegenteil: recht pfiffig sogar. Ich erkannte „I like to move it, move it“ in der Jugoversion. Dragan hörte genauer hin, wiederholte: „Ja imam buve, buve.“ Ich habe Flöhe, Flöhe. Situationslyrik vom Feinsten – das traf ins Herz des serbischen Dorfbewohners, war ganz nah dran, riss ihn mit. Im Bad gabs kein Wasser zum Händewaschen. Was machte das schon – inmitten dieser Folklore? Wer den Wunsch hatte, seine Hände zu säubern, stellte sich bloß an, redete ich mir ein und goss mir von der weißen Brause nach, die es hier in jedem Supermarkt gab – je nach Laden schmeckte sie mal großartig, mal wirklich daneben. Gerade hatte ich eine gute erwischt.

Die Oma ertrug unser Lotterleben nicht lange, weil wir nach einigen Tagen aufstanden, als sie fast schon zu Bett ging. Sie empfahl Dragan beim Abschied, sich eine serbische Frau zu suchen. Wir verließen das Land nach einer Woche und waren froh, dass die Oma uns diesmal nicht umarmen, nicht küssen wollte. Der Staub der Straße wirbelte hinter uns hoch. Der Truthahn, der nicht auf dem Teller gelandet ist, reckte seinen Hals.
Von dem Serbien-Urlaub blieben außer den Erinnerungen ein paar neue Kassetten mit Schnulzen, die ich von da an beim passiven Hören über mich ergehen lassen musste. Auch blieb die Knoblauchmanie. Dazu mehr in einer nächsten Erzählung.

Wir freuten uns auf die Slowakei und die freute sich auf uns. Glücklich strahlend erkundigten sich die slowakischen Grenzbeamten, ob wir am Balatonsee gewesen seien.
„Nein, in Serbien.“ Das Lachen der Grenzer fiel, so kurz nach dem Balkankrieg, in sich zusammen und sie kommandierten uns ab auf den Seitenstreifen. Wir sollten aussteigen. Der Hund wurde abgeführt. „Sei tapfer, Mephisto!“, dachte ich nur und hatte Angst um das arme Ding. Hoffentlich würde er nicht einer Leibesvisitation unterzogen. Olas Magnesiumpillen beschlagnahmte und untersuchte der Grenzer, dessen Gang zunehmend an den von John Wayne erinnerte. Doch dann ließ er uns gehen.
Wir investierten unser letztes Geld in slowakische Knödel, reichten dem Hund billige Grützwurst hinunter, die er vor Gier mitsamt Serviette verspeiste, genossen das Bergpanorama und waren flugs wieder in Polen, wo es regnete. „Dieselben Hackfressen wie immer“, bemerkte Ola. Nach so vielen Tagen im Auto hatten wir das Gefühl, in einer Raumkapsel unterwegs zu sein. Mit Laika, unserer treuen Begleiterin. Ola war diejenige, die es am schwersten verkraftete, dass wir nach unserer Rückkehr nicht mehr stundenlang kreisten, um einen Platz zum Übernachten zu finden; sie hatte Probleme mit dem Einschlafen. Ich hingegen hörte „Ja imam buve, buve“ und versank im Land der Träume.
Nach diesem Osteuropatrip sehnst du dich bestimmt nach der Heimat. Komm, ich nehme dich mit auf eine verrückte Wanderreise durch Deutschland!
Welcome to Üdersdorf
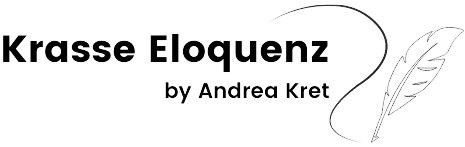



Pingback: Auswandern – nach Ungarn??? – Krasse Eloquenz
Pingback: Money, always funny – Krasse Eloquenz
Pingback: Welcome to Üdersdorf - Krasse Eloquenz