Glorreiche Ideen sind was Feines. Hier kommt eine davon: Ich stelle die Klimaanlage meines Appartements in Peking auf 18 Grad und gehe ins Bad, während draußen, vor der Eingangstür, die Schwüle in jede Ecke durchsickert, alles und jeden niederdrückt. Sie war mit mir auch hineingekommen. Überrascht bin ich, als ich beim Heraustreten, mit nassen Haaren und in einen der zum Inventar gehörenden weißen Frotee-Bademäntel gewickelt, gegen eine Kältemauer stoße. Ich denke daran, wie sich 18 Grad bei uns im Norden anfühlen, sage mir, dass 18 Grad nicht gleich 18 Grad sind, stelle die Klimaanlage wieder aus und lege mich ins Bett; es ist schon spät.
Der nächste Morgen. Die Sache sieht nicht gut aus, um nicht zu sagen: schlecht. Benebelt und mit dickem Hals wache ich auf, fühle mich wie durch den Fleischwolf gedreht. Wachträume der letzten Nacht kommen hoch: wie ich schon im Flugzeug das ungute Gefühl hatte, dass etwas passieren würde. Ein schwarzhaariges Mädchen hielt sich beim Einsteigen krampfhaft die Hand vor den Mund, ihre Freundin hatte die blassgrüne OP-Maske praktischerweise bereits aufgesetzt. Schon im Konsulat wollte ich auf die Formularfrage „Sind Sie geisteskrank?“ mit „Sind wir nicht alle ein bisschen bluna?“ antworten. Am Flughafen das nächste Formular mit weiteren Fragen: Nein, ich habe kein Fieber. Wirklich nicht. Ich fühle mich auch nicht krank, hatte keinen Kontakt zu Leuten, die Fieber haben oder gehabt haben werden oder die sich krank fühlten, meine Nase läuft nicht. Ich passiere die Wärmedetektoren am Ausgang, dann die Quarantänestation, die man für die Opfer der weltweit grassierenden Schweinegrippe eingerichtet hat, stelle mich in die Schlange mit dem darüber hängenden Schild „Aliens“ und kriege ein erstes Gefühl dafür, wie man sich wohl als Alien in Asien, fernab der Heimat, fühlt: aufgeschmissen.
Am liebsten möchte ich heute liegen bleiben, und zwar für immer. Nur der Gedanke an die Putzfrauen, die hier bestimmt sauber machen wollen, treibt mich aus dem Bett. Ich füge mich dem Unvermeidlichen, denn eins ist klar: Wenn die Putzkolonne mich krank im Bett erwischt, komme ich in besagte Quarantäne und meine gesamten Zukunftspläne, zum Beispiel diesen Sommer im Eisladen an der Ecke Farmsener Landstraße das blaue Schlumpfeis zu probieren, hätten sich im Nu zerschlagen.
Es muss sein: Ich schleppe mich ins Bad, vom Bad in die Küche, danach ins Schlafzimmer zum Anziehen. Endlich, eine Stunde später, lasse ich die Tür des Appartements ins Schloss fallen – die Alarmanlage geht los. Ich mache wieder auf, schließe sie von innen, sie geht aus. Ich gehe wieder raus, schließe ab, sie geht los. Hin und her, resigniert rein und wieder raus. Irgendwann gibt die Alarmanlage auf und ich trete erschöpft auf die Straße, erreiche mit der U-Bahn die Wangfujing Dajie. Gern würde ich Knoblauch kaufen. Und ein Messer zum Kleinschneiden und Mich-mit-Knobi-Vollstopfen, um nicht nur Vampire, sondern auch abertausende von kleinen Chinesen, die sich überall herumtummeln und vor allem weitere Bakterien und Viren mit dem natürlichen Antibiotikum auf Abstand halten. Der Plan ist gut – allerdings undurchführbar. Mit einem Messer im Gepäck komme ich unmöglich durch die U-Bahn-Kontrolle, durch den Gepäckscanner, und würde mich nur unnötig verdächtig machen. Ich steuere eine chinesische Apotheke an, sehe Krüge mit Hirn in Scheiben, getrockneten Krähenfüßen und komme mir lächerlich vor, als ich versuche, der Medizinfrau zu erklären, dass ich eine simple Aspirin brauche. Vergebliche Liebesmüh – sie versteht kein Wort von meinen wirren, pantomimisch begleiteten Ausführungen. Ich lasse mich an der Ecke nieder und trinke eine warme Pepsi, eine Wohltat für meinen geröteten Hals. Das Koffein pusht mich, sodass ich gerade nicht furchtbar erkältet, sondern bloß normal schlapp bin. Ich habe eine neue Taktik: Nicht nachdenken, einfach einen Schritt vor den nächsten setzen, die Zeit irgendwie rumkriegen. Der Rest wird schon. Und bloß nicht zu lange auf einer Bank sitzen bleiben. Das könnte Aufsehen erregen und Wächter auf den Plan rufen. Ich zahle also Eintritt, um einen der zahlreichen Pekinger Parks zu betreten, und schramme gerade noch so an einer freiwilligen Fiebermesskontrolle durch den Wachmann vorbei, der da mit einer Art weißer Plastikpistole am Eingang steht. Ich trotte durch den Park. Die Methode, einen Fuß vor den anderen zu setzen, scheint zu funktionieren. Ein Mann in einem blau-weiß gestreiften Schlafanzug kommt mir entgegen; ich denke mir nichts dabei. Irgendwann kann ich nicht mehr; die Wirkung der Pepsi lässt nach; ich setze mich, zücke sofort einen Schreibblock, um beschäftigt zu wirken, und fange an zu schreiben. Ein Passant in gelbem Gewand stellt sich an meine Seite und sieht mir über die Schulter.
„What are you writing?“
Ich erläutere ihm, dass ich meine Reise niederschreibe. Er schaut nachdenklich und fragt, warum ich nicht stattdessen Fotos mache. Ich versuche, ihm zu erklären, dass das schwarze Büchlein, das ich auf dem Schoß halte, ein Kommunikationsersatz sei, und erzähle ihm auf Nachfrage hin, dass ich aus Deutschland komme, eigentlich aus Polen, das sei jetzt kompliziert, aber auch egal. Er zeigt sich unbeeindruckt und fragt mich, ob Deutsch genauso einfach sei wie Englisch. Nun bin ich erstaunt. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass man hier Englisch für leicht hielte. Doch er ist gedanklich bereits weiter und möchte wissen, aus wie vielen Personen meine Gruppe bestünde.
„My group consists of one person“, erwidere ich lachend. Er will was sagen, doch ein weiterer Chinese, so um die 25 bis 45 Jahre, kommt auf mich zu und gibt mir zu verstehen, dass er sich mit mir ablichten lassen möchte. Der Einfachheit halber nenne ich ihn Qingquao. Wir stellen uns hin, werden von seinen Begleitern umzingelt, die in Aufruhr sind, weil sich die Gelegenheit bietet, eine Langnase zu fotografieren. Als ich ihnen meine Kamera gebe – ja, auch ich hätte gern ein Erinnerungsfoto –, ist das Staunen groß. Wen interessieren denn schon Asiaten? Doch auf Facebook kommt man mit solchen Bildern weit – weltmännisch erscheint man da gleich, global agierend und beweist damit, dass man sogar im wahren Leben soziale Kontakte hat. Die Chinesen machen gleich vier Fotos: stehend, sitzend, lächelnd, ernst dreinblickend. Eine Frau, die zum Grüppchen gehört und ein paar Brocken Englisch spricht, möchte wissen, ob ich „Only one?“ bin. – „Yes!“
Sie erzählt mir, sie würde in der Bank of China arbeiten. Ich sage im Gegenzug etwas von „translation agency“ und hole, um mich für den weiteren Weg zu orientieren, einen Reiseführer aus der Tasche. Ihre kleine Tochter schaut auf meine Karte und auch die Frau wird neugierig. „English?“ – „No, German.“ Mit erstauntem Blick stellt sie fest, dass Deutsch wohl anders sei als Englisch. Yes, indeed! Schau doch mal hier – wir haben lauter Großbuchstaben mitten im Satz. Hier ist einer – und hier – und da auch. Und Pünktchen auf den Buchstaben ebenfalls, jeweils zwei. Dass es dann aber noch ein Eszett gibt, das wie ein B aussieht, jedoch wie ein S ausgesprochen wird, dieses aber durch die Rechtschreibreform seltener geworden ist, enthalte ich ihr vor. Alle Bilder sind gemacht und ich verabschiede mich von der Truppe höflich mit einem „Do widzenia“. Dass es Polnisch ist, juckt keine Sau. Die polnische Sprache ist in diesem Land zur Kommunikation perfekt geeignet, ebenso gut wie jede andere – die Message kommt an.
Am folgenden Tag nach dem Aufstehen frage ich mich, ob ich inzwischen erhöhte Temperatur habe. Wie auch immer die Antwort darauf ausfallen würde: Es nützt alles nichts, weiter im Programm! Ich besuche die Pekingoper. Die Platzanweiserin führt mich zu einem Tisch für sechs Personen und platziert, als auch die restlichen fünf eintrudeln, ein Kännchen Jasmintee auf unseren Tisch, gibt jedem ein Schälchen mit Knabberkram und stellt eine Schale mit Melonenstücken dazu. Auf der digitalen Tafel über der Bühne wird eingeblendet, dass man sich schnellstmöglich bei den Showverantwortlichen melden solle, wenn man bei sich oder beim Stuhlnachbarn Symptome von Husten, Schnupfen oder Fieber entdeckt. Ich rücke etwas weg und mache mich gefasst auf eine aus mehr als hundert Akten bestehende Pekingoper (so die vorab eingeholte Wikipedia-Information), eine Hand in den Nüssen und gedörrten Pflaumen. Da tritt eine Ansagerin vor den gelben Vorhang. Mit ihrem riesigen Kopfschmuck erinnert sie an Leia aus „Krieg der Sterne“, nur dass sie bunt, schrill und asiatisch wirkt. Die Frau erklärt den Zuschauern, was sie im Laufe des Abends erwartet. Von dieser Annahme gehe ich zumindest aus. Eher unwahrscheinlich ist, dass sie das Wetter für morgen ansagt oder auf die Problematik der Umweltverschmutzung in China eingeht. Sie macht Platz für eine stark geschminkte Dame in edlem blauen Gewand, die mit verzweifelter Miene deutlich macht, was wir Zuschauer auch ohne die aufleuchtende Schrift in Simplified English gewusst hätten: Ihr Geliebter hat sie wegen einer Nonne verlassen. Doch wer wird eine Dame ewig vor sich hin klagen lassen? Ein alter Mann mit langem weißen Bart, schneeweißen Augenbrauen und lustigem blauen Hut und einem Ruder in der Hand kommt hinzu. Es entspinnt sich ein ausgedehnter Dialog mit vielem Hin und Her, in dem die Dame in hoher Tonlage Chinesisches von sich gibt, der Flößer in tieferer Tonlage darauf antwortet, dabei manchmal das Ruder hebt, es wieder senkt, sie währenddessen heftig weiterdiskutieren, er sie auf sein imaginäres Floß verfrachtet und sie einen ebenso imaginären Fluss überqueren. Englische Überschriften gibt es schon lange nicht mehr; die Handlung ist so voller Symbole, dass sie sich jedem erschließt. Außer mir. Einige Kinder prusten los und ich will gerade gehen, doch da fängt die Dame an zu singen. Eine Erlösung, denn nun kann man wieder mitlesen. Sie hofft, bald in Lin An anzukommen (hoffe ich auch), wo sie ihren Geliebten Mister Pan trifft (was will sie noch von dem?!!) und wo die beiden nie wieder voneinander lassen, „like a Mandarin duck“. Das zumindest steht auf der Leuchttafel. Wie eine Mandarinente??? Egal.
Nach einem sich bis zur Unerträglichkeit steigernden musikalischen Höhepunkt des Orchesters legt der Flößer sein Ruder zur Seite, die beiden gehen von der Bühne und die Moderatorin gibt die Erholungspause bekannt. Pause? Ein missgestimmtes Raunen geht durch das Publikum. Alle wollen wissen, ob das mit der Rückeroberung hinhaut. Stattdessen bekommen wir Tee nachgeschenkt und ich kann darüber sinnieren, ob wohl der zweite Akt genauso langweilig sein wird wie der erste. Außerdem bahnt sich ein Husten an, ein verräterischer. Schon stürmen acht seltsame Gestalten in bunten, schärpenartigen Kostümen auf die Bühne und wir werden per Leuchtschrift darüber informiert, dass mit der Fortsetzung der herzzerreißenden Lovestory Asche ist, wir unsanft herausgerissen wurden, um stattdessen zu sehen, wie der Affenkönig Sun Wukong mit acht Aarhats (what the f***?) kämpfen wird. Na, immerhin lassen sich die Aarhats mit den bunten Gewändern nicht so hängen wie unsere Unglückliche aus dem vorherigen Akt, sondern bringen Schwung in die Bude: Da springt eins der Wesen mit hervorstehender Stirn hoch und macht, zack, einen Salto, ein anderes mit Riesenohren, an denen große Kreolen baumeln, wehrt mit seinem Schwert den Affenkönig im pelzartigen Kostüm mit Kappe ab; dieser hält eine rote Lanze in der Hand, die er gegen den nächsten Aarhat mit langer gebogener Nase richtet. Der wiederum weicht geschickt aus, und ein anderer springt dem König auf den Rücken, stößt sich ab und macht auf dem Boden eine Rolle vorwärts. Keiner singt, keiner klagt, keiner singt klagend. Stattdessen Action, Action, Action, während die Schwerter und Ringe durch die Gegend fliegen, auf diversen Köperteilen balanciert werden, von wagemutigen Akrobatikübungen begleitet. Das Publikum ist begeistert, klatscht und bekommt als Reaktion darauf eingeblendet, dass man sich auf unseren nächsten Besuch in Peking freue. Was? Schon zu Ende? Zwei Szenen, sechzig Minuten, 28 Euro? Alle klatschen, ich ein wenig kräftiger als der Rest, denn ich bin außer mir vor Freude, dass es vorbei ist und dass mich keiner meiner Sitznachbarn trotz des vereinzelten Hüstelns denunziert hat.
Nach der Vorstellung latsche ich blöd im benachbarten Viertel herum, nach wie vor ausgelaugt, versuche aber, Haltung zu bewahren, da ich mich von den zahlreichen Überwachungskameras und patrouillierenden Polizisten beobachtet und durch die Grippe-Hinweisschilder beunruhigt fühle. Eine Frau mit Mundschutz huscht vorbei und ich überlege, ob es an der Zeit ist, meine aus der Heimat mitgebrachte Maske in Aktion treten zu lassen. Zum einen mache ich mir Sorgen, mich tatsächlich mit Schweinegrippe anzustecken, zum anderen aus Rücksicht auf meine Mitmenschen. Die Zahl der Atemschutzträger nimmt täglich zu, so kommt es mir jedenfalls vor. Hauptsächlich chinesische Frauen jeder Couleur – von jung und brav über hip und aufgemotzt bis hin zu nicht mehr ganz jung und eher altbacken: Mundschutz ist Pflicht. Und ich, die ich mich permanent in den Ansteckungsbrennpunkten aufhalte, von Tausenden von Touris aufgesucht, laufe einfach so herum, schnupfe auch noch heimlich in den Straßenecken meine Nase aus, wofür man sich hier mehr als schämen muss – viel eleganter ist da das Rotzhochziehen –, und drehe mich demonstrativ weg, sobald jemand in meiner Nähe hustet. So rücksichtslos und egoistisch können nur Europäer sein!
Ich gehe weiter. Es erfordert eine Menge Contenance, mir nicht anmerken zu lassen, dass es mir nicht berauschend geht, mich trotz wackeliger Beine aufrecht zu halten, um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, ich hätte was. Als meine Mutter überraschend anruft, schlage ich mich tapfer, bestätige: Ja, alles okay. Obwohl großes Wehklagen genau das Richtige für mich wäre, am besten im Stil der Pekingoper. Volle Kanne. Diesmal halte ich es asiatisch-dezent. Mit geht es gut. Ich versuche gar nicht erst, die irgendwo stationierten Spitzel, die unser Gespräch sicher mitverfolgen, zu täuschen, indem ich Polnisch spreche. Die heutige Technik ist zu weit: Die lassen sich das ratzfatz ins Chinesische übersetzen und ich bin, hüstel, dran. Ich lege auf, gehe, so weit mich meine Beine tragen können, setzte mich dort auf einen Kantstein, sehe eine Gruppe Kinder vorbeilaufen, eine Oma in einer Schürze, einen Mann, der vor sich hin klatscht, sitze so eine halbe Stunde, beobachte und merke, wie es mir geringfügig besser geht. Endlich.
Wenn ich gedacht hatte, damit sei die Quarantänegefahr gebannt, so irre ich bitter: Am Tag darauf finde ich mich im Zentrum für traditionelle chinesische Medizin wieder, das wir, meine für heute gebuchte Gruppe und ich, spontan nach einer organisierten Tour zur Chinesischen Mauer aufsuchen. An Stelle einer Töpferwerkstatt. Noch ehe ich überlegen kann, ob meine Resthalsschmerzen hier verheerende Auswirkungen haben könnten, wird mir ein Infrarotthermometer an die Stirn gedrückt. Die Empfangsdame nickt nicht wie bei den anderen, sondern schaut auf die Anzeige und wartet. Und wartet. Und nickt dann doch; ich darf passieren.
Wir werden in einen Raum gebracht, in dem wir uns einen Vortrag zur chinesischen Medizin anhören sollen. Man erzählt uns von Yin und Yang und fügt hinzu, dass man im Westen auf andere Weise heilen würde als im Osten. Hier sitzen wir also im chinesischen Medizinzentrum und bekommen im Brustton der Überzeugung gesagt, dass die chinesische Medizin sich unterscheide. Man will uns nicht überfordern, indem man auf Details eingeht. Daher komprimiert in 45 Minuten: Sie ist anders. Überhaupt nicht gleich. Gut, dass das einmal klargestellt wurde. Einen kostenlosen Puls- und Zungencheck hat man ebenfalls im Angebot, für alle, die Bedarf haben. Es melden sich zwei Briten, ein Amerikaner und ich. Um die Wartezeit bis zur Ankunft der Ärztin zu überbrücken, kriegen alle eine kostenlose Fußmassage von den hiesigen Medizinstudenten. Die bräuchten ein wenig Praxis. Und etwas Trinkgeld, wenn genehm. Der Amerikaner protestiert vehement, als ein bildhübscher junger Mann in traditionellem schwarzen Kostüm vor ihn tritt, um ihm die Füße zu massieren. Nein, nicht mit ihm. Er möchte seine Füße – bitte sehr! – von einer weiblichen Masseuse bearbeiten lassen. Den ungewollten Jüngling kriege ich ab. Und bin im siebten Himmel. Ich möchte ihn am liebsten mitnehmen nach Deutschland. Da das nicht geht, drücke ich ihm statt der empfohlenen 20 Yuan Trinkgeld ganze 40 in die Hand. In der Zwischenzeit ist eine Ärztin hinzugekommen. Die Frau untersucht den Puls und die Zunge des Briten, blickt skeptisch. Dieser beteuert auf Nachfrage der Dolmetscherin hin, dass er nichts hätte, definitely not – hört er zum ersten Mal. Die Dolmetscherin redet geduldig auf ihn ein, erklärt ihm ausführlich die Konsequenzen, wenn er nicht jetzt und hier handelt. Es endet damit, dass der Brite mehrere Päckchen Medizin mit in sein Heimatland nehmen wird. Schon kommt die Ärztin auf mich zu, doch ich winke von Weitem ab. Ich will nichts von irgendwelchen Krankheiten wissen – habe genug Sorgen mit denen, von denen ich weiß. Außerdem ist mir die Sache zu heiß. Ein Blick auf meine belegte Zunge und wieder stehe ich unter Schweinegrippeverdacht. Diesmal aber wirklich. Hier lässt sich keiner was vormachen.
Lust auf weitere Chinasatiren? Dann lies:
Pekingente, pikant
„Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie?“
„Ein Schlüsselerlebnis“
„Man-wah und ruff uff’n Tisch“
Oder möchtest du lieber erfahren, wie es ist, als Deutscher in China zu leben?
„Wie im Paradies“: Herr Müller in China
Titelbild: © iStock/tatianazaets
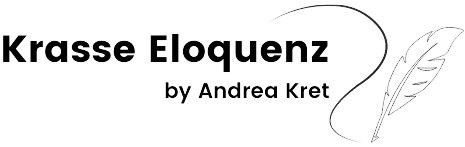



Pingback: Ein Schlüsselerlebnis – Krasse Eloquenz
Pingback: „Wie im Paradies“: Herr Müller in China – Krasse Eloquenz
Pingback: Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie? – Krasse Eloquenz
Pingback: Der Hund mit dem Winkepfötchen. Eine Flughafen-Story. – Krasse Eloquenz
Pingback: Nackt in der großen Stadt – Krasse Eloquenz
Pingback: Pekingente, pikant – Krasse Eloquenz
Pingback: Näher am Äquator - Krasse Eloquenz