Ich weiß nicht, warum, doch war der Schlüssel verbogen. Vielleicht ist er mal heruntergefallen oder es hat sich jemand draufgesetzt. Der Schlüssel zum Treppenhaus des Wohnblocks im Rahlstedter Weg machte an einer Stelle eine leichte Drehung um die eigene Achse. Als wenn das nicht schlimm genug wäre: Den Ersatzschlüssel hatte irgendein Exfreund verschludert und es ließ sich nicht nachvollziehen, welcher. Naiv, wie ich war, dachte ich, ich könnte mir einfach einen zweiten anfertigen lassen. Für den Notfall. Ha! Das gute Stück gehörte zu einer Schließanlage und durfte keinesfalls nachgemacht werden – erklärte mir ein freundlicher Herr vom Schlüsseldienst.
Beim Baumarkt, in dem ein Schlüsselzentrum untergebracht war – so schnell ließ ich nicht locker –, erklärte man nicht freundlich, sondern winkte sofort ab. Nein, nein, nein. Es half kein koketter Augenaufschlag, kein Zwinkern. Das Anfertigen einer Kopie stellte ein schweres Delikt nach dem StGB dar, gegen das man selbst mit raffiniertesten Balzritualen machtlos war. In Italien hätte es vermutlich geklappt. Ich hingegen war in Deutschland. Norddeutschland, um genau zu sein. Kein Zweitschlüssel also. Meinem Schicksal wollte ich mich dennoch nicht ergeben. Das wäre ja gelacht! Nun musste ich ihn erst recht haben. Doch wie? Der bürokratische und vorschriftsmäßige Weg über den griesgrämigen Vermieter schien mir zu aufwendig und wäre sicher nicht ganz billig geworden.
Die Schlüsselgeschichte erlebte eine Wiederbelebung im Frühjahr, durch einen Kurztrip nach Barcelona, der Stadt der lachenden Sonne und der lachenden Schlüsseldienstmitarbeiter. Kaum machte ich Schuhe und Leisten im erstbesten Laden aus, schon war ich drin. Der lachende Schlüsselnachmacher untersuchte meinen aus der Art geschlagenen Schlüssel gründlich, schaute wieder hoch und ließ einen Wortschwall auf mich niederprasseln, von dem ich nichts verstand und der in einem Kopfschütteln mündete. Meine hilflose Miene half nichts. Nichts zu machen, wirklich nada. Ich war ja nicht in Italien.
Aber in China, da musste es was werden! Dort verbrachte ich meinen Sommerurlaub. In Asien wusste man sicher nichts von Schließanlagen, DIN-Normen und ISO-Codes. Da war man noch ursprünglich, echt. Wovon Reifen, Pumpen und Werkzeuge, die hier herumlagen, zeugten: Ich hatte so etwas wie eine Werkstatt entdeckt. An der Seite ein Rollwagen, auf dem eine Reihe Schlüsselrohlinge hing – ein Wink des Schicksals, befand sich diese Garage doch in Fußnähe zu meinem Hotel. Am nächsten Tag kramte ich meinen Türschlüssel aus dem Koffer und machte mich auf in Richtung der improvisierten Werkstatt. Ich zeigte dem älteren Chinesen, offenbar dort beschäftigt, den Schlüssel, der schon vieles mitgemacht hat, deutete auf die am Wagen hängenden Rohlinge, setzte eine erwartungsvollen Miene auf. Er sah sich den Übeltäter samt Krümmung an, blickte besorgt und erging sich in einer ausgedehnten Tirade – diesmal auf Chinesisch. Ich zuckte mit den Achseln, verstand nichts. Hatte nicht einmal die Phrase „Ich verstehe nicht“ in dieser Sprache auswendig gelernt, da bei einem deutschen Akzent generell schlechte Aussichten auf Verständigung bestanden. Der kleine Junge, der dabei war, versuchte auf seine Weise, mir das Ganze verständlich zu machen. Leider sprach auch er Chinesisch, sodass mit der gelungenen Kommunikation wieder Asche war. Ich schaute fragend drein, was ihn dazu animierte, beim Reden seine Hände zu Hilfe zu nehmen, damit ausladende Gesten zu vollführen und anschließend eine Bewegung, als ob er einen Gegenstand entzweibrechen würde. Ich nickte bedauernd. Ja, der Schlüssel war hin. Inzwischen waren andere Leute zu uns gestoßen. Der ältere Mann, mit dem ich zuerst gesprochen hatte, wandte sich an einen jüngeren und weihte ihn in das Problem meines Krummschlüssels ein. Dieser gab seine Meinung kund. Ein Passant war hinzugetreten, der sich bisher im Hintergrund gehalten hatte. Hoffnung keimte auf – der musste etwas wissen! –, aber nach dem ersten Wort aus seinem Munde war klar: Auch er hatte sprachlich nichts Europäisches im Angebot. Nach längerer Beratschlagung holte der ältere Mann ein Handy aus seiner Hosentasche, einen Nokia-Knochen, und rief einen mysteriösen Dritten an. Er schilderte der Person am anderen Ende der Leitung die prekäre Lage und berichtete mir im Anschluss von den Ergebnissen des Gesprächs. Die waren hochinteressant – und auf Chinesisch. Der Bub unterstütze ihn wie zuvor mit Simplified Chinese – vergeblich. Die beiden wandten sich hilfesuchend an den jungen Burschen. Der wird ja wohl ein paar Brocken Englisch in der Schule gehabt haben! Er lächelte nur verlegen.
Doch dann! Dann hatte das Kind plötzlich einen Geistesblitz. Euphorisch rief es aus: „Tustaj“, und korrigierte, als ich immer noch nichts kapierte, zu „Tjusdei“. Gott, war die Freude groß. Endlich kam was zu mir durch. Tuesday, natürlich! „Ah, tomorrow!“, erwiderte ich hocherfreut. Dienstag war also der Tag, an dem sich alles aufklären sollte. Eine Welle der Erleichterung ging durch die versammelte Gesellschaft. Fast wollte man sich auf die Schulter klopfen, sich umarmen. Interkulturelle Verständigung war doch kein Buch mit sieben Siegeln. Der kleine Junge sprang in die Luft. Ich bedankte mich überschwänglich mit „Xexe“, verbeugte mich sicherheitshalber – und ging am Dienstag in den Zoo. Wer weiß, was die Bande mit meinem Schlüssel vorgehabt hatte.
Lust auf eine weitere Chinasatiren? Dann lies gern:
Pekingente, pikant
„Schweinegrippe“
„Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie?“
„Man-wah und ruff uff’n Tisch“
Und in diesem Interview erzählt ein Deutscher, wie es ist, seit fast 40 Jahren in China zu leben:
„Wie im Paradies“: Herr Müller in China
Titelfoto: © iStock/Nuthawut Somsuk
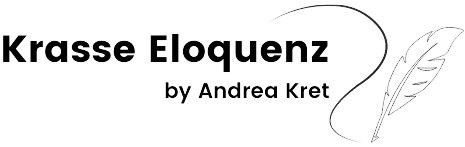



Pingback: Schweinegrippe – Krasse Eloquenz
Pingback: „Wie im Paradies“: Herr Müller in China – Krasse Eloquenz
Pingback: Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie? – Krasse Eloquenz
Pingback: Nackt in der großen Stadt – Krasse Eloquenz