Ich weiß nicht, warum, aber ich fand es anstrengend, mich so sehr, sehr langsam fortzubewegen. Die Bewegung in Slow Motion strapazierte meine Füße. Trotz der Eingewöhnung vorab in Kuala Lumpur und auf Bali haute mich die Hitze in Singapur um. Obwohl ich nur ein paar Kilometer weiter am Äquator war als in KL.
Irgendwie fand ich es dort auch sympathischer: Das Leben spielte sich draußen ab. Hier lebte man in Shopping Malls; die Singapurer stehen auf Shopping Malls, das sah ich sofort. Womit sie mich vor eine Herausforderung stellten: Wollte ich von drin etwas zu trinken herausholen, war es in etwa so, als würde ich von der Sauna direkt in eine Ice Bar hineingehen. Augenblicklich war ich schockgefrostet, das nasse T-Shirt versteifte an meinem Körper, die Schweißtröpfchen am Hals erstarrten zu Eis, noch bevor sie weiterkullern konnten.
Es war wie in einem Computerspiel: Die Heldin hatte die Aufgabe, innerhalb der Mall möglichst schnell ein Lebensmittelgeschäft zu finden, die Kohle augenblicklich aus der Tasche zu ziehen und zu hoffen, dass der Verkäufer sich nicht verzählte. Oder die ältere Dame vor einem zu viel Kleingeld loswerden wollte. Dann nichts wie raus; die Zeit lief. Und wenn man Glück hatte und rechtzeitig wieder in die Sauna hinaustrat, war man hinterher vielleicht tatsächlich nicht erkältet. Bis zum nächsten Besuch.
Ich trank gierig aus der Flasche, wiederholte das Ganze eine Stunde später. Und trank. Immerhin hatte ich hier, anders als zum Beispiel in Paris, nicht das Problem, eine Toilette zu finden. Ich musste einfach nicht. Das hineingeschüttete Wasser verdunste wenige Augenblicke später über meine Haut, was spätestens dann unangenehm wurde, als ich neben einer Asiatin in Businessdress saß, die den Laptop vor sich aufgeklappt hatte. Während ich vor mich hinoxidierte, fragte ich mich erstens, ob sie es wohl bemerkte, und zweitens, ob Asiaten denn nicht schwitzten.
Zum Glück war ich auf dieses Café gestoßen, denn in der Stadt hatte es nur sehr wenige Bänke gegeben, sodass sich der zu Fuß wandelnde Tourist nirgends ausruhen konnte. Bloß musste man hier seinen Kaffee und Kuchen mit Kreditkarte zahlen. Nein, Cash wolle er nicht, erklärte mir der junge Mann am Tresen, dessen Englisch ich kaum verstand. Beim Essen sah ich auf dem Handy nach und mir wurde klar, warum das Land so schweißtreibend war: Von Kuala Lumpur hierher war es kein Katzensprung, wie es auf der Karte ausgesehen hatte, sondern ganze 450 Kilometer. 450 Kilometer näher am Äquator.
Ich beschloss, mich fortan per Taxi fortzubewegen – und tauchte in eine mir bis dato unbekannte Welt ein. So bunt wie Singapur selbst, ein Glücksrad, bei dem ungewiss war, an welcher Position es stehenbleiben würde. Alle Ethnien, Lebensstile und Temperamente waren hier vertreten: der chinesische Fahrer, der ohne Punkt und Komma quasselte, mir ganz Singapur erklärte, keine Redepause ertragen konnte – oder der Hindu, dessen Wagen unzählige bunte Kettchen schmückten. Ein anderer war ganz entspannt und ließ sich von seinem Radio alle 15 Minuten erklären, dass es besser sei, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Sie alle einte, dass ich ihr Englisch kaum verstand, mich daher für einen Augenblick tatsächlich nach China, Indien oder sonst wohin versetzt fühlte.
Der Gast hatte selbstverständlich ebenfalls Pflichten. Ein Aufkleber an der Seitentür besagte, dass auch ein Taxifahrer ein Recht auf eine ruhige, gewaltfreie Arbeitsumgebung hätte. Deshalb drohte eine Strafe bis zu 5000 Singapurdollar, sofern man einen Fahrer bepöbelte oder ihm gegenüber handgreiflich wurde. Etwas billiger kam man weg, wenn man das Fahrgeld nicht dabeihatte. Das machte dann 1000 Dollar. Wiederholungstäter kamen in den Knast.
An der Orchard Road, den Champs Elysées Singapurs, bekam ich gar nicht erst ein Taxi. Ich war dort gelandet, weil es hieß, das sei „the place to be“ in Singapur. Die Besitzerin des Hotels in Bali, die mich zum Flughafen gebracht hatte, erzählte, dass sie nur einen Tag in Singapur gewesen sei – die Unterkünfte waren einfach zu teuer. Sie sei schnurstracks zur Orchard Road gefahren. Zum Shoppen. Ich erinnerte mich an ihre Worte, beschloss, die lange Straße langsam abzugehen, doch das Interessanteste, was ich zwischen unzähligen klimatisierten Shopping Malls sah, was ein einfacher Eiswagen: Ein zahnloser Mann holte Eiscremeblöcke aus der Tiefkühltruhe, schnitt ein passendes Stück ab und packte es zwischen zwei Toastbrotscheiben – oder was ich dafür hielt. Eine Art Eissandwich.
Ich versuchte, ein Taxi heranzuwinken, ohne Erfolg. Obwohl weiß Gott wie viele davon herumfuhren. Trotz des fleißigen Winkens wurde ich geflissentlich ignoriert. Taxifahrern war es selbstredend verboten, einfach so anzuhalten, um Gäste mitzunehmen. Das wusste ich zu der Zeit bloß noch nicht. Und wenn man in einer eigens dafür vorgesehenen Bucht tatsächlich ein Fahrzeug erwischte, konnte man zu Shiva, Buddha oder wahlweise einer anderen Gottheit beten, dass man auch wirklich mitgenommen würde.
„Nö, dein Ziel ist mir zu blöd.“
Ganz so flapsig kam es dann doch nicht rüber, die Message war dennoch unmissverständlich. Immerhin war am Flughafen alles in geordneten Bahnen verlaufen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die in der Schlange stehenden Ankömmlinge wurden vom Aufseher verschiedenen Haltebahnen zugeordnet und von dem ihnen zugeteilten Taxifahrer sicher in ihr Hotel gebracht. Na ja, im Grunde kannten die Singapurer die Bedeutung des Worts „unsicher“ gar nicht, erklärte mir mein Fahrer. Abgesehen davon, dass das Land mit Kameras vollgespickt sei, hätte hier jeder Angst vor der Prügelstrafe und würde es sich zehnmal überlegen, bevor er ein Verbrechen beging.
Interessantes Modell. Vielleicht könnte man in Deutschland so endlich den Mittelspurblockierern beikommen. Oder den Telefonierern im Ruhewagen. Um ehrlich zu sein, hatte ich Angst gehabt, das Land überhaupt erst zu betreten, denn schon im Flugzeug wurde mit der Todesstrafe gedroht. Für Drogen und so’n Krempel. Nicht dass ich welche mitgehabt hätte. Was aber, wenn mir jemand was zusteckte? Ich, die ich so harmlos aussah, war da sicher ein dankbares Opfer.

Der Taxifahrer, der mich zum Bootsanleger beim Fullerton Hotel bringen sollte, verstand mich nicht. Er war Chinese und sprach kein Englisch. Nach langem Hin und Her, in dem ich ihm pantomimisch schippernde Boote vormachte, einigten wir uns auf „Fullerton“; die Boote würde ich wohl selbst finden. Ich hoffte zumindest, dass wir uns einig waren, denn sein „Fullerton“ klang natürlich anders, als ich es mir üblicherweise vorstellte. Ich traute dem Ganzen nicht, ließ nebenbei mein Navi laufen, um zu verfolgen, ob wir uns tatsächlich in die richtige Richtung bewegten. Das Fullerton aber war sehr beliebt. Alle wollten dorthin, so schien es zumindest; wir kamen in einen handfesten Stau, von da an ging es nur im Flaniertempo weiter. Mein Handy zeigte noch anderthalb Kilometer Entfernung zum Ziel an.
Zwanzig Minuten und einige Meter später sagte ich zaghaft:
„Maybe I could get out …“
Er verstand mich nicht. Brav standen wir weiter. Ich wurde unruhig, hatte keinen Bock, den Restabend im Taxi zu verbringen. Zumindest das bekam er mit und manövrierte zwischen den Spuren hin und her, was uns einen bescheidenen Erfolg von zehn Metern bescherte. Die Minuten krochen dahin, die stoische Ruhe, die ich ohnehin nie gehabt hatte, schmolz dahin. Jetzt waren es maximal 400 Meter bis zum Ziel.
„Can you stop?!“
Er verstand. Wollte trotzdem aber nicht so recht.
„Wir sind ja noch gar nicht da“, deutete er pflichtbewusst an. Ich wiederholte nachdrücklich, dass ich rauswollte. Was blieb ihm anderes übrig, als links ranzufahren und mich zu entlassen.

Ein Hotel in Singapur zu finden, ist eine Kunst für sich. Oder vielmehr hartes Geschäft. So ein kleines Land, so viele Leute, die dort leben wollen – die Grundstücks- und Mietpreise fallen da astronomisch aus. Meine Technik, online ein erschwingliches, aber dennoch angenehmes Zimmer zu buchen, versagte. Billige Unterkünfte gab es vielleicht im Zehnerzimmer oder in der Abstellkammer, aber aus dem Alter war ich raus. Beziehungsweise noch nie drin gewesen.
Ich musste mich also für ein wirklich teures Hotel mit durchschnittlicher Gästebewertung entscheiden, auweia. Wie die wohl zustande kam? Das Hotel war einfach und natürlich sauber, denn für schmutzige Zimmer drohte vermutlich die Prügelstrafe. Aber was ist in Singapur schon nicht sauber? Wie viel hatte ich nicht über die berühmte Singapurer Sauberkeit gehört? Von Putzfrauen, die ins Klo hineinlaufen, nachdem man drin gewesen ist, und noch einmal für einen abziehen, von drakonischen Strafen beim Ausspucken eines Kaugummis. Doch ich muss sagen: So sauber fand ich das gar nicht. Schmutzig war es nicht. Aber jetzt nicht sauberer als in Deutschland, vielleicht mal abgesehen von der Reeperbahn, wo man aufpassen musste, dass man nicht in Erbrochenes trat – während darüber Döner zum Mitnehmen verkauft wurde.
Das Hotel mutete fast schon futuristisch an: Der Fernseher auf dem Zimmer war eingeschaltet, als ich eintrat, zur Begrüßung stand auf dem Fernsehschirm mein Name. Woher kannte er meinen Namen??? Das WC erinnerte an eine Flugzeugtoilette, war sehr platzsparend eingerichtet. Insgesamt war das Zimmer heruntergekühlt, obwohl ich keinen Luftzug ausmachen konnte. Es war fast schon zu kalt, nackt darin herumzulaufen, wobei das hier in Singapur ohnehin verboten war.
Im Fahrstuhl stieg ich dazu, als schon ein Herr drin war, drückte auf die Zahl acht. Die Acht leuchtete auf, verschwand dann wieder.
„Sie müssen die Karte davor halten, sonst geht das nicht“, erklärte mir der Mann, der mit mir drin war, und lachte. „Big brother is watching you.“
Auf dem Weg ins achte Stockwerk erzählte er mir, er sei Grieche, der in Belgien wohnte und fragte im Gegenzug, ob ich wegen der Klimaanlage die Kapuze aufhätte. Ich nickte dankbar. Der Erste, der das erkannt hatte.

Das Wahrzeichen der Stadt – neben dem Merlion, den eh kein Schwein kannte –, das Schiff, das auf drei Säulen thronte: die Marina Bay Sands. Da musste man einfach rauf. Oder nicht? Ich entschied mich dafür, dass man musste. Also musste ich. Aber erstmal Mut antrinken – ich hatte einen frischgepressten Guaven- und einen Mangosaft intus und hing bei den Gardens by the Bay ab. Die Sonne war am Untergehen, es wehte eine kühle Brise, langsam ließ es sich aushalten. Die Jogger, die an mir vorbeiliefen, bewegten sich im Schneckentempo. Ob das Laufen so überhaupt etwas brachte? Von oben sahen sie aus wie Ameisen. Nein, okay, das war gelogen. Erstens traute ich mich gar nicht, so genau nach unten zu schauen, zweitens wäre vermutlich eh nichts zu erkennen gewesen, denn hier war es verdammt hoch. Ich war im 56. Stock.
Was spielte sich im Kopf eines von Höhenangst besessenen Menschen ab? Natürlich auf Platz eins ein terroristischer Anschlag. Jetzt und hier. Der perfekte Augenblick wäre es sicher; das Deck war gut besucht. Millimeter für Millimeter tastete ich mich auf der gläsernen Aussichtsplattform vor; ich wollte es wirklich wissen. Vor allem wollte ich wissen, wie die bunt beleuchteten Supertrees von oben aussahen. In der Tat weniger spektakulär als unten – und die zur wechselnden Beleuchtung passende Musik konnte man hier oben ohnehin nicht hören. Umsonst gewartet. Umsonst die Angst, das Glasdeck, auf dem ich mich tatsächlich schon seit über einer halben Stunde befand, könne jeden Augenblick abbrechen.
Das letzte Singapurer Frühstück – ja, leider war es schon so weit, mehr als drei Nächte in der Luxusstadt konnte ich mir nicht leisten –, nahm ich beim Fastfoodgiganten ein. Ich kaute an einem Burger, dessen Patty aus Shrimps bestand, und blickte zu der Standsäule, auf der eben dieser Burger beworben wurde: Die Säule war mit Absperrungen versehen. Für den Fall, dass jemand sie nicht sah und dagegenlief. Was man nicht bedacht hatte: Diese Person konnte ja genauso gut gegen die Absperrung laufen, die nämlich war inkonsequenterweise nicht zusätzlich gesichert. Ich witterte Unlogik, auf die man die Singapurer Regierung, die die Vorschriften zum Schutze der Menschheit erließ, tunlichst hinweisen musste.
Mayo zu Pommes kannte man hier nicht, auch nicht, als ich das Wort pantomimisch darzustellen versuchte. Dann eben nicht. Ich war die Einzige, die draußen saß – alle anderen waren ins kühle Innere geflüchtet. Ein straffes Programm lag hinter mir. Ich bildete mir ein, jede Facette Singapurs wenigstens im Ansatz gesehen zu haben. Fehlte nur noch eins: der Dschungel.
Der Taxifahrer zweifelte, als ich ihm mein Fahrziel nannte. Da wollte ich wirklich hin? Der Hotelpage kannte die Adresse gar nicht erst. Das Netz wiederum wusste, dass man da nie, nie, nie zur Mittagshitze hinsollte. Und wann kam ich an? Na ja, so kurz nach zwölf. Waren ja nur vierzehn Kilometer. Außerdem wurde hier zu der Zeit sogar gejoggt, obwohl meine Wetterapp anzeigte, dass die Bedingungen fürs Joggen schlechter nicht sein konnten. Der Läufer nutzte wohl eine andere App. Außerdem keuchte er nicht einmal. Trotz dieser Spur der Zivilisation, die in dem Jogger bestand, war mir etwas mulmig zumute, denn ich war vorher nie in einem Dschungel gewesen. Ein Dschungel ist schon eine Hausnummer. Wildschweine sollte es hier geben. Und Warane. Eine Miniaturversion sah ich am Wegesrand in eine Höhle kriechen. Hörte Heuschrecken, die hier Metallsägearbeiten durchführten. So zumindest klang es. Ein ohrenbetäubender Lärm; und das nannte sich Natur.
Und dann saß da etwas mitten auf dem Weg. Damit hatte ich nun nicht gerechnet. Ich blieb stehen. Das Etwas saß weiter.
Ich wagte mich ein paar Schritte vor, die mich allerdings kaum beruhigten. Das Etwas hatte Fell. Oh, ein Affe – schlimmer gings nicht. Die Affen hier auf dem MacRitchie Trail sollten besonders wild sein, das zumindest berichtete das Internet. Ich hatte wegen der Hitze meinen Schlapphut dabei; den hatten die Affen auf Bali schon besonders anspringenswert gefunden. Doch die Affen auf Bali waren harmlos gegen diese Dschungelaffen, würde ich sagen. Zu allem Übel lag in meinem Rucksack eine Banane. Ob er davon wusste? Der Affe schaute mich interessiert an, als ich bedächtigen Schrittes an ihm vorbeiging, sagte aber nichts, erwähnte die Banane nicht mit einem Wort.
Dann die zweite Herausforderung auf diesem Weg. Diese hier lebte zum Glück nicht. Ob ich im Anschluss an die Herausforderung noch lebte, war eine andere Frage. Entschlossen kletterte ich auf den Treetop Walk hinauf und stand vor einer Hängebrücke, deren Ende ich nicht sehen konnte. Zwar war sie mit Stahlseilen gesichert, was hier in Singapur so etwas wie die absolute Sicherheit bedeutete, ich würde aber lügen, wenn ich behauptete, der erste Schritt würde mir leichtfallen. Zumal es kein Zurück gab. Ein Schild informierte mich darüber, dass dies eine One-Way Street sei. Eine Einbahnstraße. Hoffentlich nicht im metaphorischen Sinne. Während ich so darüber nachdachte, ob ich diesen Point of no Return tatsächlich überschreiten sollte (eine Zuwiderhandlung würde strengste Konsequenzen nach sich ziehen, da war ich mir sicher), sah ich eine Person auf der Brücke. Die mir entgegenkam! Was um alles in der Welt …? Offensichtlich hatte dieser Mann eine Sondergenehmigung; es war der Park-Ranger. Beim Näherkommen fragte er mich, ob ich Angst hätte.
„Woher wissen Sie das?“
„Sie umklammern krampfhaft das Geländer.“
Ja, ich hätte Angst, entgegnete ich, setzte aber, wie um es ihm zu beweisen, den ersten Schritt auf die Brücke.
„Aber ich schaffe das schon.“
Skeptisch blicke er mir nach, wie ich einen zaghaften Schritt nach dem anderen tat, nicht nach unten schauend. Nach dem zwanzigsten zaghaften Schritt traute ich mich, meinen Blick über die Baumspitzen schweifen zu lassen. Noch ein paar Meter weiter ließ ich das Geländer los, kramte vorsichtig die Kamera aus der Tasche und machte ein Foto links, eins rechts. Noch einmal kurz vorsichtig in die Tiefe gucken. Und dann weiter, stetig weiter – bis der Scheiß endlich vorbei war und ich hinterher sagen konnte: Ich habe es gepackt. Seht her, ihr norddeutschen Wanderfreunde, die ihr über Wiesen und Wälder wandert – wart ihr schon mal im Dschungel unterwegs? Nein? Tut mir leid für euch.
Mittlerweile glitschte mein Rucksack auf meinem Rücken hin und her. Die Träger rutschten mir von den Schultern. Ich schwitzte am Bauch und überhaupt in allen Regionen, die naturgemäß zum Schwitzen angelegt waren. Meine Arme glänzten vor Schweiß – obwohl ich diesen Wanderpfad meditativ langsam abging und am Ende fast die doppelte Zeit brauchte wie in den heimischen Gefilden. Ich kam an das Endstück der Tour und war vor die Wahl gestellt: den einfachen Weg zurück zum Ausgangspunkt, ohne großes Gedöns. Oder den Weg über die Planken am See. Wo Affen saßen.
Wie ich hatten sich die Affen für die Planken entschieden, weil sie den See malerisch fanden und ihn, auf den Planken sitzend, gut im Blick hatten. Vor Affen mit Nachwuchs, so hieß es in meinem Stadtführer, solle ich mich in Acht nehmen. Und auch überhaupt den direkten Augenkontakt meiden. Das war leicht dahergesagt. Hier, wie in Südeuropa, hatte jeder Affe Nachwuchs. Und glotzte mich unbeteiligt an. Wobei ich mir von eine paar Affen den schönen Weg nicht madig machen wollte. Energisch zog ich meinen Schlapphut auf den Kopf und wagte mich langsam durch die Affenmenge. Bewusst schaute ich weg, sah nur aus dem Augenwinkel, wohin ich trat. Im Slalom umschiffte ich die Affengrüppchen, die auf dem schmalen Steg verteilt waren.
So viele Herausforderungen an diesem Tag gemeistert; fehlte nur noch die letzte: so weit abkühlen, dass ich in ein Eisfachtaxi steigen konnte, das mich wieder in die Zivilisation zurückbrachte. Ich setzte mich hin, betrachtete die Fotos, die auf der Wanderung entstanden waren, schaute in meinen Reiseführer, was ich heute noch so vorhatte, schlenderte zu dem Imbiss, den es hier tatsächlich gab. Und merke, dass mein dünnes Hemdchen nicht trocknen wollte. Bei der hohen Luftfeuchtigkeit würde es sicher nie trocknen, wie mein Handtuch damals auf Malta, das im Laufe der Woche einfach vergammelt war. Ich hätte es auswringen können.
Beim Einsteigen zog ich eine Sportjacke an, setzte die Kapuze auf, dazu noch einen Mundschutz gegen die kalte Luft. Dazu bat ich den Fahrer, die Klimaanlage etwas herunterzudrehen. Er fragte, ob es in seinem Taxi roch. Ich versicherte ihm, dass dies nicht der Fall war, und erzählte ihm die Leidensgeschichte von mir und den Klimaanlagen. Ich glaube, er verstand wenig. Immerhin verstand er, dass ich zur Foodrepublic @ Vivocity gefahren werden wollte, denn er erkundigte sich nach dem exakten Eingang. Keine Ahnung, ich wollte nur zum Hawker Center auf dem Dach, erklärte ich ihm. Diese Auskunft aber empfand er als nicht zufriedenstellend. Welcher Eingang? Keine Ahnung, ich war ja noch nie da gewesen, Mensch! Als er nicht lockerließ, sagte ich, er solle einfach den Eingang nehmen, der am schnellsten zu erreichen war. Langsam wurde das an meinem Körper klebende T-Shirt immer klammer. Lange würde ich das nicht durchhalten.
Als ich mir meine Trainingsjacke vom Leib gerissen hatte, konnte ich mich auf die Suche nach der Foodrepublic machen. Hier ging ein Einkaufszentrum ins andere über – ich war natürlich im falschen gelandet. Erst galt es, an ein Getränk zu kommen; nach der Dschungeltour war ich arg entwässert. Doch auch das klappte nicht auf Anhieb. Wie immer fügte ich hinzu, dass ich den Saft ohne Eiswürfel wollte. Ich hatte einfach keinen Bock auf Halsschmerzen. Die Verkäuferin nuschelte etwas wie: Wenn ich ihr einen Dollar mehr gebe, kann ich mehr Saft haben. Nö, wollte ich nicht. Ich wollte keinen Dollar mehr; ich wollte auch nicht mehr Saft. Ich schüttelte den Kopf. Und bekam einen Mangosaft mit Eiswürfeln, fischte sie mit den Fingern heraus und begab mich aufs Deck von Vivo City, wo man einen schönen Blick auf Sentosa Island hatte. Meine Füße tauchte ich in den flachen Pool, der extra der Erfrischung der müden Shopper diente, und stellte meine Sandalen neben dem Schild für „Bitte nicht auf dem Deck umherlaufen“ ab. Niemand lief hier, nicht einmal Kinder. Wenig später saß ich heruntergebeugt an meinem Tisch und schaufelte Ente mit braunem Reis, Tofu, Ingwer und einem Chiliei in mich hinein, inzwischen arg ausgehungert. Ich stieg auf meinen aus Deutschland mitgebrachten Löffel um, den ich in Hamburg mal in einem Asiashop erstanden hatte, denn die Kombi aus Reis und Stäbchen wollte nicht so recht klappen.
Was stand heute noch auf dem Programm? Ein Besuch in einem weiteren Foodcourt, ebenfalls ein Must-see: die Markansutra Gluttons Bay. Die Vielfraßbucht. Wie gern hätte ich hier Murtabak probiert, ein Gericht, das grob aus dieser Gegend stammte. Das hat schon auf Bali nicht geklappt. Dort hieß es „Finished!“, gerade als ich zur Bestellung ansetzte. Hier war das Gericht zwar nicht „finished“, diesmal war ich es. Als Vielfraß hatte ich mich bereits in der Foodrepublic geoutet; jetzt aber ging nichts mehr. Ich hatte Durst statt Hunger. Und kam dem Geheimnis der Eiswürfel auf die Spur: In Singapur war es nicht möglich, die Eiswürfel einfach abzubestellen. Das sah ja nicht aus … ein Glas, das zu drei Vierteln gefüllt ist. Hier musste man dazubezahlen, damit alles im Rahmen der Anständigkeit blieb. Ich entschied mich diesmal doch für einen Eistee, in Erwartung etwas Ähnlichen wie in Europa. Eistee Zitrone oder Pfirsich, die Standardnummer halt. Das Zeug hier schmeckte anders, unglaublich süß.
Aus der Markansutra Gluttons Bay fand ich nicht wirklich heraus, in der Gegend waren die Straßen weiträumig aufgerissen und gesperrt, keine kursierenden Taxis in der Nähe. Ich fragte eine junge Frau nach dem Weg. Die riet mir, die MRT zu nehmen. Jetzt, nach drei Tagen ohne, kurz vor Ende, sollte ich mich mit dem sicher nicht unkomplexen System der Untergrundbahn auseinandersetzen? No way. Sie nahm mich mit, um mir zu zeigen, in welche Richtung ich musste. Wir gingen über unzählige klimatisierte Tunnel, bogen ab, gingen weiter. Am Ausgang angekommen, bestand sie darauf, mich nach oben zu begleiten, um mir auf ihrem Handy den Weg zu zeigen. Auch mit ihrer Hilfe klappte es nicht so recht, weil hier ebenfalls alles abgesperrt war. Irgendwann sah ich einen Wegweiser mit der Aufschrift „Merlion“. Endlich ein Orientierungspunkt, und der Weg war sogar begehbar. Am Meerlöwen nahm ich mir ein Taxi und erreichte mein Hotel viel später als geplant. Dennoch arbeitete ich meine täglichen Pflichten ab: Fotos auf Facebook posten, die Wanderung samt Fotos im Wanderprogramm hochladen – für alle eifrigen Wanderer, die sich mal hierher verirrten. Meiner Freundin musste ich die Erlebnisse des Tages noch per Sieben-Minuten-Sprachnachricht schicken und konnte um ein Uhr endlich ins Bett.
Da bemerkte ich erst, dass ich in der Markansutra Gluttons Bay ein Zaubergetränk zu mir genommen hatte. Nach diversen Einschlafversuchen gab ich es um drei Uhr auf und packte stattdessen meinen Koffer. Ich schaffte es dann doch, in dieser Nacht eine Stunde zu schlafen, wobei es ein unruhiger Schlaf wurde: Wer gab mir die Garantie, dass mein Wecker nicht ausgerechnet heute versagen würde und ich zurückblieb? Ausschließen konnte man so etwas nie. Am Flughafen kaufte ich für meine Geldreste ein Mitbringsel für die Arbeitskollegen. Es waren Durian-Süßigkeiten. Leider wurden sie von den meisten Kollegen verschmäht, nachdem ich im Meeting weitschweifig ihre Nachteile angepriesen hatte. Eine Kollegin war mutig, berichtete mir am nächsten Tag aber, dass sie seitdem dauernd aufstoßen musste und jedes Mal der Kotzfruchtgestank mit aufstieg. Ich selbst hatte auch probiert, rannte keine Minute zu früh zum Klo und hatte Tage später noch einen ekeligen Geschmack im Mund. Zumindest konnte ich meine exotische Reise auf diese Weise verlängern.
Möchtest du lieber satirisch in andere Länder reisen?
Kuala Lumpur?
China?
Malta?
Oder startest du doch lieber ganz gemütlich zu einem Roadtrip durch Skandinavien?
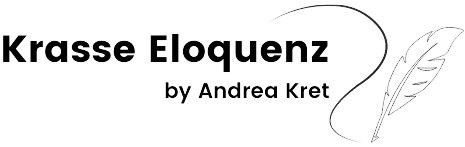



Pingback: Nackt in der großen Stadt – Krasse Eloquenz
Pingback: Pipi in Paris – Krasse Eloquenz