Wer einen Kulturschock braucht, bucht in der Regel eine Fernreise, am besten Mumbai oder Bangkok. Dabei kann man in den heimatlichen Gefilden durchaus das eine oder andere Abenteuer erleben. Ich wette, das glauben Sie nicht. Hätte ich mir auch nicht geglaubt. Das Jahr 2020 hat mir hier die Augen geöffnet. New York und Kanada wären dran gewesen. Mann, wär das gut gekommen …
Es kam noch besser.
Der Einstieg war zäh. Wie in jedem fernen Land, in dem ich Urlaub machte, bestand meine abendliche Routine auch im Harz daraus, mich mit Lebensmitteln einzudecken, im Bett zu naschen und den Abend Tagebuch schreibend Revue passieren zu lassen – einen aufregender Tag hinter mir, unbekannte Früchte in der Papiertüte aus dem Supermarkt, ein exotisches Getränk bei lauer Sommerluft, die durch das Fenster hineinwehte. So in etwa sah das pure Glück aus.
Ich latschte den nasskalten Weg vom Supermarkt in Braunlage zurück zur Unterkunft, die Plastiktüte gefüllt mit Chips, die einem täglich in Werbeclips präsentiert werden, und einem Nudelsalat, dem ich noch nie etwas abgewinnen konnte. In dem Augenblick wurde mir bewusst: Dies hier ist nicht New York.
Gut, immerhin konnte ich hier meinem zweiten Hobby frönen: dem Wandern. Was sich in NY vermutlich nicht ganz so einfach gestaltete. Ich nahm mir einen mittelhohen Berg vor: 16 Kilometer rauf und runter durch das Bodetal. Besonders die Aufstiege machten mir Spaß: Nach den Strapazen erwarteten mich oben zur Belohnung nicht nur Bratwurst und Waffeln, sondern auch eine mächtige Ausschüttung von Endorphinen.
Noch war ich unten, ging langsam, aber stetig auf eine Familie zu, die in den zehn Minuten, in denen sie in meinem Blickfeld gewesen war, schon zweimal Halt gemacht hatte. Es lag an der Tochter. Immer wieder fiel sie zurück; es schien, als wäre sie in die sportlich gestaltete Urlaubsplanung nicht eingeweiht gewesen. Das zarte Stnimmchen palaverte so lange, bis die Mutter sich das Vorschulkind auf die Hüfte setze und ihren Weg nach oben wiederaufnahm. Der kleine Bruder trippelte nebenher. Mühsam bewegte sich die Karawane weiter.
Wenn die das so auf den Gipfel schaffen wollten: Reeeespekt. Wir waren erst auf dem ersten Viertel. Noch bevor ich die Familie eingeholt hatte, tat es die bittere Realität: Die Mutter stellte das Mädchen wieder auf den Boden, stütze ihre Arme auf den Knien ab, um zu verschnaufen. Sie gab nicht auf, trieb das Mädel an. Das ging ein paar Schritte, verfiel wieder ins Jammern, bis der Vater es nicht aushielt, es nun seinerseits mit dem Tragen versuchte. Sie verschwanden aus meinem Blickwinkel. Was aus ihnen geworden ist, ist nicht verbürgt …
Ich konzentrierte mich auf die großen und kleinen Felsbrocken, aus denen der Weg bestand. Unaufmerksamkeit war hier keine gute Idee, zumal ich ein Faible für Wandersandalen hatte: Nichts und niemand bekam mich in fette, knöchelhohe Wanderstiefel, aus denen dicke Merinosocken herausragten. Ich stand beim Wandern auf Sommer, Luft und eine frische Brise um die Zehen, nicht auf Saunamief und Schweißausbrüche im Fußbereich – Steine hin oder her.
In meinem Sichtfeld erschien eine andere Familie. Ich sah auf den ersten Blick, dass auch hier die Chancen auf das Gipfelkreuz mager waren: Die Frau führte ein Baby an der Hand, das zaghaft einen Stein nach dem anderen erklomm, sich zentimeterweise nach oben kämpfte.
„Und, schaffen Sie es auf den Berg?“ Ich lächelte die Frau an.
„Ja, schaffen schon. Aber vielleicht nicht heute.“
Ich überholte den dazugehörigen Mann mit Tragegeschirr auf dem Rücken. Schritt für Schritt ging ich weiter, spürte mittlerweile meine Oberschenkel, und auch mein Hirn hatte zu tun, indem es jeweils den günstigsten Auftrittspunkt für diese moderate Kletterei errechnete.
Die nächste Familie begegnete mir erst viel weiter oben. Die vier ordnete ich in die Kategorie „Sonntagsausflügler“ ein. Der Vater, der sich offenbar über die Jahre eine nicht zu vernachlässigende Plauze erarbeitet hatte, wollte wissen, wie weit es nach unten sei.
„Gute Frage“, überlegte ich. Wie lange war ich unterwegs gewesen? Und wie viele Kilometer werden es wohl gewesen sein? Das Navi wusste es.
„2 Kilometer.“ Ich staunte selbst nicht schlecht. Gefühlt hatte ich fast die Hälfte meiner Wanderstrecke hinter mir und sollte nur zwei Kilometer vorangekommen sein?
„Ist ja machbar“, sagte das Familienoberhaupt, schaute fragend zu seiner Frau. Die war nicht überzeugt, sah eher nach einem gemütlichen Spaziergang am Flussufer aus denn nach einer Steinkraxelei, und das bergab. Zu ihrem knielangen Kleid trug sie grüne Sandalen, die ich mir nicht so recht auf den Felsbrocken vorstellen konnte. Das Bergabgehen über einen unebenen Boden, das wusste ich als alte Wanderin, erforderte ein komplexes Zusammenspiel aus Konzentration und Motorik: Mit den Knien federte man das Gewicht des Körpers ab, den die Schwerkraft kopfüber zum Fuß des Berges zog.
Ob die vier je unten ankommen würden: Man weiß es nicht. Ich nutzte meinerseits die Gelegenheit zu erfragen, wie weit es noch zum Gipfel sei, wurde enttäuscht: Ich war schon da. Gleich um die Ecke befand sich der Hexentanzplatz, auf dem – wie ich feststelle – der Teufel los war. Lauter Menschen, die per Seilbahn heraufgekarrt worden waren und diesen sommerlichen Tag hier oben nutzen wollten. Die Schlangen am Bratwurststand schätzte ich auf eine halbe Stunde, ließ den Rummel links liegen und aß mein Brot auf der anderen Seite des Berges, wohin sich nur wenige Besucher verirrten.
Rheinland-Pfalz suchte ich nur durch Zufall auf – das Bundesland entpuppte sich als Fettnäpfchen. Die schmal aus dem Boden herausragenden Externsteine zogen Jahr für Jahr Mystiker jeglicher Couleur an, hieß es. Ich war interessiert. Was man bei der Bildersuche im Internet als weniger aufmerksamer Besucher nicht mitbekam: Stets waren es dieselben Steine, die da abgelichtet waren, aus unterschiedlichen Perspektiven und bei unterschiedlichem Lichteinfall. Da ham se einfach nur vier Steine hingestellt, die aus dem schönen Elbsandsteingebirge stammen könnten, die restliche Umgebung unterschied sich kaum von der in der norddeutschen Tiefebene.
Die Eifel kannte ich vom Namen her, wusste allerdings nicht, was ich mir darunter vorstellen sollte. Sie lag auf meinem Weg nach Süden chronologisch als Nächste, daher quartierte ich mich kurzerhand in einem Nest in der Vulkaneifel ein, das so gottverlassen war, dass ich vor Begeisterung gleich vier Nächte buchte – wer braucht schon New York, wenn er in Üdersdorf abhängen kann? Ich buchte trotz der Bad- und Toiletteneinrichtung in Dunkelbraun, die mich kurz zurückweichen ließ. Welche Schandflecken hatte man hier zu verbergen?
Mit der Gastgeberin der Pension handelte ich aus, dass ich um 9.30 Uhr frühstücken würde; man ließ mich, die ich mir zu fein war, früh aufzustehen, trotzdem dezent spüren, was man von mir hielt – die Dame schloss den Frühstücksraum nur widerwillig auf.
Den Kaltwassergeysir quasi vor der Haustür bekam ich erst am letzten Abend zu Gesicht, obwohl er durch seine Lage außerhalb von Island eine kleine Sensation darstellte. – Vorher hatte ich Abenteuer zu bestehen.
Doch erst wachte ich nach der ersten Nacht mit Bissen auf, dachte an Serbien und die Flöhe dort, war verwundert, wie die es hierhergeschafft hatten. Meiner Laune taten sie keinen Abbruch. Heute kam es mir gelegen, zu einem so frühen Frühstück gezwungen zu werden: Ich fuhr zur Saarschleife, um dort einen Premiumweg zu begehen. Der hieß so, weil er dem Wanderherz alles bot, was es begehrte: idyllische Wege mit tollen Aussichten, viele Perspektivwechsel. Nur wenn ein Wanderweg genug Abwechslung bot, wurde ihm das Premiumsiegel des Deutschen Wanderinstituts verliehen.
Bereits nach der Hälfte dieser Traumschleife konnte ich dies bestätigen: Japp, der Abstieg war schon mal premium. Eine abwechslungsreichere Strecke war mir bisher nicht untergekommen. Gekrönt wurde das Erlebnis durch den fjordartigen Blick auf die Saar, die an dieser Stelle einen weitläufigen Bogen machte. Im Geiste stellte ich schon den Text für mein heutiges Facebook-Posting zusammen und machte mich an den Aufstieg.
Ein schmaler Trampelpfad führte zwischen Bäumen den Berg wieder hinauf – noch mehr Abwechslung! Ich fotografierte noch schnell das Hinweisschild „Gefährliche Wegstrecke. Begehbar auf eigene Gefahr“ für Insta, nahm es schulterzuckend zur Kenntnis. Was wurde in Deutschland nicht alles als gefährlich bezeichnet: wenn man bei Rot über die Ampel ging, wenn man ab fünfzig nicht an einer Darmspiegelung teilnahm, beim Kaffeetrinken den Löffel nicht vorher aus der Tasse entfernte. Was konnte beim Wandern schon gefährlich sein – dachte ich Flachlandtirolerin. Vor allem hier im Saarland?
Gutgelaunt setzte ich meinen Weg fort, freute mich, als der Pfad noch schmaler wurde (ich liebe schmale Pfade!), mein Herz klopfte, als er sich zu einem Weg am Abhang entwickelte. Ein Schuss Gefahr, wie spannend. Sorgsam und nun etwas langsamer setzte ich einen Fuß vor den anderen – mittlerweile passte nur noch einer auf den Pfad. Ich kam an eine Kurve, an der der Weg sich um einen Felsvorsprung schlängelte. Alles, was dahinter lag, konnte ich nicht sehen. Mit sicherem Tritt würde ich die Kurve nehmen, perfekt ausbalanciert.
Unter mir der Abgrund.
„Ach komm schon, Andrea, das schaffst du locker. Das haben schon Abertausende vor dir geschafft“, meinte die Abenteurerin in mir.
Die Vernünftige aber riet, die Lage genau abzuschätzen, bevor ich den entscheidenden Schritt tat. Ich fasste zusammen: schmaler, mit glitschigen Steinen gesäumter Pfad, enge Kurve, keine Möglichkeit, sich festzuhalten – außer an einigen Zweiglein. Ich schaute nach unten und stellte fest, dass ich schon ziemlich weit oben war.
„Sorry, Abenteurerin, dat wird nix“, sagte ich.
„Aber du kannst doch nicht den ganzen Weg umsonst gemacht haben. Das Belohnungseis kannste vergessen, wenn du kneifst.“
„Dann ist das halt so. Schau doch selbst: Die Chancen, dass ich es um die Kurve schaffe, stehen 40 zu 60. Das ist etwas wenig, findest du nicht?“
Die Abenteurerin schwieg. Vermutlich weil sie wusste, was jetzt kam: Erleichtert drehte ich um, hatte mich mit der Entscheidung schnell abgefunden – kannste nix machen –, setzte meinen Weg schwungvoll wieder fort. Brachte einige Meter hinter mich, war verwundert, dass der Weg sich, statt wieder breiter zu werden, stetig verschmälerte, es immer steiler wurde. Als es nicht mehr weiterging, blieb ich stehen.
Scheiße. Ich war vom Weg abgekommen.
Ein Blick nach oben: Dort war er irgendwo, der richtige Weg. Ich schaute nach unten auf meine Füße, die sich kaum noch in der Schräge halten konnten. Schaute noch einmal nach oben: zu steil, um wieder hinaufzukommen.
„Was macht man in so einer Situation, Frau Professorin?“, schrie die Abenteurerin.
Die andere schwieg.
Die Abenteuerlustige übernahm notgedrungen die Kontrolle, ging den Weg, der längst keiner mehr war, weiter geradeaus. Er wurde immer beschwerlicher, immer häufiger rutschten meine Füße ab. Ich beugte meine Knie, um mich einigermaßen zu halten, sank nach unten. Ging weiter. Rutschte wieder, auf dem Hintern diesmal, versuchte, mich an Ästchen festzuhalten, die aus dem Boden ragten, vergebens. Nicht nur von der prallen Sonne, der ich nun ausgesetzt war, bekam ich Schweißausbrüche, stand auf, watete weiter in der losen Erde, rutschte noch ein Stück nach unten, erreichte einen steinigen Abschnitt. Lauter faustgroße Steine lagen dort, an denen ich mir die Hände verbrannte, als ich mich beim Vorwärtskraxeln daran festzuhalten versuchte.
„Endlich Halt“, dachte die Vernünftige, als ich wieder mit Schwung nach unten gerutscht war, auf dem Po landete und sitzenblieb. Die Sonne brannte mir aufs Hirn; ich konnte nicht mehr.
Erst hörte ich es ganz oben. Klack. Klack, klack.
Dann wurde mir klar, was los war. Oben auf dem Berg lösten sich langsam Steine, verursacht durch die Steinverschiebung hier unten. Quasi wie bei Tetris. Immer mehr kullerten herunter, nahmen Fahrt auf.
„Eine Steinlawine, na prima. Ich wollte schon immer unter einer Lawine begraben werden.“ Die Abenteurerin hatte ihren Sarkasmus immer noch nicht verloren.
Und ich, ich dachte zum zweiten Mal innerhalb von einer Stunde: „Scheiße.“
Blieb sitzen. Hörte immer mehr Steine herunterkommen. Die Steinmasse polterte herunter, an mir vorbei. Dann war Ruhe.
Und ich noch da.
Auch wenn die Sonne nach wie vor brannte.
Zaghaft meldete sich die Vernünftige zu Wort: „Dort unten, siehst du das? Da ist ein Netz, das die Steine auffangen soll. Wenn du da langgehst, gelangst du irgendwann an sein Ende und bist gerettet. Nur geh in Gottes Namen weiter.“
Ich tat, wie mir geheißen, erreichte in einer Mischung aus In-der-Erde-Versinken und Rutschen das Netz, stellte fest, dass es dicht war, damit kein Spaziergänger unten die Steine abbekam – und mit Himbeersträuchern bewachsen.
Ich kletterte wieder eine Etage höher, ging über unwegsames Gelände – Sträucher, Büsche –, durchquerte Gruben. Ende nicht in Sicht. Kämpfte mich weiter und fragte die Vernünftige in mir, ob dies der Augenblick sei, die Bergrettung zu rufen.
„Wie peinlich“, kam die Abenteurerin dazwischen. „Das hier ist nicht mal ein richtiger Berg!“
Ich gab mich geschlagen, stolperte weiter und entdeckte ein kleines Loch im Zaun. Beim Näherkommen sah ich: Es war mit einem Metallstab aufgestemmt worden. Offensichtlich hatte noch jemand diesen Albtraumpfad unterschätzt. Mein Handy und das Portemonnaie packte ich in meinen Rucksack, ließ ihn den Berg hinabrutschen.
„Bye, bye, Habseligkeiten.“
Sobald er unten aufgeschlagen war, legte ich mich flach auf den Rücken, hielt mich am Netz fest, schloss die Augen, stieß mich ab. Rutschte, rutschte, blieb an Himbeersträuchern hängen, doch die Schwerkraft war stärker. Da war mein Rucksack.
Ich kämpfte mich durch das Gestrüpp, bis ich endlich wieder auf dem breiten Weg unten am Fjord stand.
Mit zitternden Knien näherte ich mich dem Fluss, wusch meine pechschwarzen Ellenbogen und Schienbeine, klopfte den Hintern ab und versuchte, die Schürfwunden so gut es ging zu säubern.
Hatte ich es geschafft? Nicht ganz. Ich stand immer noch unten, mein Wagen aber war oben geparkt. Den Weg, auf dem ich zwei Stunden zuvor nach unten gegangen war, wieder hinaufgehen?
„Boah, ne!“, meldete sich die Abenteurerin zu Wort.
Die Vernünftige, die in der Notsituation immer noch funktionierte, schlug vor, auf dem Navi zu schauen, wo genau wir uns befanden. Eine Raststätte in einiger Entfernung! Ich schaute in der Suchmaschine nach einem Taxiunternehmen, bestellte das Fahrzeug dorthin – „Erkennungszeichen rotes Oberteil, leicht verschmutzt“ – und setzte mich gut sichtbar auf einen Poller.
Endlich im Wagen, begann ich, meine Erlebnisse abzuspulen. Der Taxifahrer sagte nichts. Ich fühlte mich unverstanden, verstummte ebenfalls.
Er bekam Mitleid mit mir: „War es der Zickzackweg, den Sie gegangen sind?“
„Ja, genau!“
„Der soll nicht so schwer sein.“
Oben gab ich ihm 30 Euro für die zwei Kilometer Luftlinie, die mich vom Berggipfel trennten, und ging zur Aussichtspunkt, von dem man die Saarschleife am besten sehen konnte. Dieses Bild braucht jeder Deutschlandreisende in seiner Sammlung: eine Landzunge, mit einem dichten Baumteppich überzogen, um die sich ein Fluss schlängelt.
„Hat sich der Tag doch gelohnt“, waren sich die Abenteurerin und die Vernünftige einig, auch wenn Letztere ergänzte: „Ab jetzt nur noch Seniorenstrecken.“

Für meinen nächsten Tag, diesmal in Freiburg, verordnete ich mir das Kürzertreten. Das war dort auch gut möglich, das Problem war in der Stadt ein ganz anderes: Es war grün und kreisrund.
Mein Hotel lag in der Umweltzone und eine Umweltplakette hatte ich nicht. Oder vielmehr nicht mehr, seit bei einem Sturm ein Ast meine Frontscheibe in ein gläsernes Puzzle verwandelt hatte.
„Theoretisch habe ich eine Plakette der passenden Farbe“, würde ich zu meinem Freund und Helfer sagen, der mich freundlich auf den Missstand aufmerksam machte. „Nur ist sie halt gerade nicht dran.“ Nachsichtiges Nicken.
Diese Geschichte glaubte ich mir selbst nicht, recherchierte stattdessen im Internet, was mich der Spaß des Erwischtwerdens kosten würde, ließ mich dennoch nicht davon abbringen, der Innenstadt eine Stippvisite abzustatten; ich parkte in der Tiefgarage. Und suchte zuerst eine Apotheke auf. Nach einer weiteren Strecke von Bissspuren, die am Morgen diesmal an meinem Oberschenkel aufgetaucht waren, hatte ich meiner Freundin am Telefon von meinem Flohverdacht erzählt.
„Sind bestimmt Wanzen“, war ihre Antwort.
„Wie – Wanzen? Doch nicht in Deutschland!“ Trotzdem bemühte ich die Bildersuche im Internet, recherchierte zuerst hoffnungsvoll nach Flohbissen. Nee! Sahen ganz anders aus. Die Wanzenbisse hingegen waren ein Volltreffer: Bettwanzen hießen so, weil sie es sich im warmen Bett gemütlich machten, wo sie sich nachts auf ihre Opfer stürzten. Um diese nicht in Alarmbereitschaft zu versetzen, injizierten sie ihnen eine Minibetäubung, sodass die Bisse erst Stunden später zu jucken begannen. Wenn die kleinen Kerlchen schon mal am Werk waren, legten sie eine ganze Wanzenstraße an – und von denen hatte ich mindestens drei auf meinem Körper.
„Wenn Sie Pech haben und ihre Schmutzwäsche im Koffer aufbewahren“, meinte die Apothekerin, „werden sie die Wanzen mit nach Hause nehmen.“
Eine Desinfektionsspray für den Koffer gab es nicht. Tolle Aussichten. Waren wir auf dem Weg nach Freiburg vielleicht schon zu zweit, zu dritt, zu zehnt gewesen? Ich inspizierte am Abend jedes Wäschestück, wendete jede Socke, hatte dabei wenig Hoffnung, da der Großteil meiner Kleidung dunkel war, um nicht zu sagen: schwarz. Wie auch die Wanzen. Die Schmutzwäsche wusch ich noch am selben Tag. Und betete.
Den nächsten Morgen verbrachte ich damit, diverse Tankstellen in der Nähe abzutelefonieren. Die Kassierer wussten nichts davon, dass sie eigentlich grüne Plaketten vorrätig haben sollten, obwohl es so doch im Internet gestanden hatte. Zum Glück war eine große Werkstattkette besser informiert. Ich sollte einfach vorbeikommen und mir das gute Stück abholen. Als Gegenleistung bot ich dort neben ein paar Moneten meine Sprachdienste an: Der Angestellte versuchte gerade herauszufinden, ob der Mann mit osteuropäischen Akzent, der an seinem Beratungstresen stand, eine Start-Stopp-Automatik hatte. Der aber hatte Fragezeichen in den Augen, sprach auch kein Englisch.
„Polnisch“, sagte er auf Nachfrage.
„Ich kenne so einige Sprachen, aber Polnisch gehört nicht dazu“, meinte der Angestellte. „Spricht hier jemand Polnisch?“, rief er nach hinten in Richtung Werkstatt.
„Ja, ich!“
Ich dolmetschte dem Polen, dass es in dem Fall – er hatte nämlich wirklich eine Start-Stopp-Automatik – nicht billig werden würde.
Auch in Baden-Württemberg musste ich mir eine Wanderung geben. Der vielgepriesene Premiumweg schreckte mich ab; ich wählte den Geißenpfad, der an einem Schwarzwälder Landhaus mit Hochbalkon startete – und fand mich in einem Heimatroman wieder: Hier, auf diesem Pfad, auf dem sanften Hang hätte auch Heidi auf der Bank sitzen können, auch wenn Heidi gar nicht aus BaWü kam. Ich war begeistert, stratzte drauflos und fand mich einige Kilometer später bei einer Einkehr wieder, wo ich den Seniorenteller nahm – nachdem ich mich vergewissert hatte, dass man mir die Bratwurst und die Rösti nicht püriert servieren würde. Rentnern, so nahm man hier an, würde eine Wurst statt der zwei reichen. Aber auch sonst allen anderen Menschen, die in naher Zukunft nicht an Adipositas leiden wollten.
Ich haute rein.
Zum Bodensee ging es immer bergab die Autobahn entlang. Welche Freude! Und Spritersparnis. Eingehender Anruf: Meine Freundin erkundigte sich nach den Wanzen, ich aber konnte nichts Genaues sagen. Schwül war es gewesen und meine Haut juckte permanent hier und da – ob nun vom Schweiß oder von den lustigen Tierchen.
„Spätestens in Hamburg werde ich es sicher wissen.“
Die Bodenseer ließen sich eine Übernachtung teuer bezahlen. Im Grunde konnte ich sie mir nicht leisten, bereute meine Entscheidung aber dennoch nicht: Die Gegend war herrlich, fast war es hier wie an der Ostsee, nur dass die See hier ein See war. Noch vor Sonnenuntergang sprang ich mit meinen Sandalen ins Wasser – ich hatte nicht damit gerechnet, dass dies auch ein Badeurlaub werden würde und meine Badeschuhe vergessen. Selbstverständlich war ich zu geizig, mir die überall erhältlichen Ersatzschlappen für 10 Euro zu kaufen. Ich hatte ja welche zu Hause.
Die schnuckeligen Ortschaften rund um den See waren jeden Cent wert, den ich hier für das Hotel ausgab. Wobei der See aus meiner Sicht im Englischen zu Unrecht „Lake Constance“ hieß – die Stadt Konstanz war uncharmant und nichtssagend. „Lake Überlingen“ hätte es besser getroffen.
Ein paar Orte weiter, in Uhldingen, gab es am Automaten Wurst, Fisch und Kartoffeln. Und für diejenigen, denen das noch nicht reichte, Nutella, Eier, Sekt und Energydrinks. Ich war schockverliebt.
Auch das Hotel ließ sich nicht lumpen und fuhr zum Frühstück alles auf, was man sich ausmalen konnte: Die Rezensenten aus dem Internet überschlugen sich vor Lob. Selbst ich kam nicht umhin, neben der Dachschräge, die mich davon abhielt, sitzend im Bett zu lesen, bei meiner Bewertung das opulente Frühstück zu erwähnen, das ich beide Male mit einem leichten Überfressungsbrechreiz verließ. War ja alles bezahlt …
In Unteruhldingen gab es neben den Fressalienautomaten auch die Pfahlbauten, die ich selbstredend aufsuchte, wo ich aber wie so oft zügig durchzumarschieren gedachte. Das war zu Coronazeiten nicht ganz so einfach: Die Marschrichtung war vorgegeben – die Besichtigungsroute eine Einbahnstraße. An einer der Hütten kam es zum Stau. Unzufrieden blieb ich stehen, lugte nach vorn, um zu sehen, was los war. Sah nichts.
„Stehen wir hier, weil drin ein Vortrag gehalten wird?“
Jemand in der Schlange nickte.
„Ich will keinen Vortrag hören“, polterte der Typ hinter mir und kämpfte sich, nicht so recht um Abstand bemüht, nach vorn. Ich folgte ihm in seinem Windschatten. Auch mich interessierte das Leben von anno dazumal nicht so; ich war in Geschichte immer eingenickt. – Einige Schlangensteher rümpften ihre Nase.

Nach den seichten Spaziergängen am Bodensee sollte es im Allgäu wieder zur Sache gehen. Ich wanderte: steil runter zu den Buchenegger Wasserfällen, dann wieder hinauf. Zum Ende hin wie immer die Einkehr: Auf der Alpe gab es gebackenen Biokäse – und einen zotigen Wirt dazu. Beim Bezahlen rundete ich den Betrag auf: „14 Euro.“ Ich gab ihm einen Zwanziger.
„Du bist ein böses Mädchen, willst Sex von mir.“ Kalauer, ick hör dir trapsen.
„Wieso?“ Ich tat überrascht. Denn natürlich ergaben 20 Euro minus 14 genau 6. Wie lange hat er wohl auf diesen Tag gewartet? Ich überlegte, ob er bei uns im hohen Norden eine Anzeige wegen sexueller Belästigung am Hals hätte, und sagte: Ja, ja, sechs will ich, genau, klopfte mir auf den Schenkel.
An der Rezeption meiner Allgäuer Unterkunft empfing mich die Besitzern überschwänglich und wortreich; ich verstand vieles, nickte an den richtigen Stellen. Vom Touristenpass war die Rede, auch diese Information nahm ich zur Kenntnis. Ich wurde nach oben auf mein Zimmer gebracht.
Später, am Skilift vom Fellhorn, fragte der Herr an der Kasse, ob ich denn einen Touristenpass hätte.
„Eigentlich schon, aber grad nicht da.“
Ein Déjà-vu.
Das mich 27 Euro kostete, denn so viel sollte ich für die Fahrt mit dem Lift ohne das Allgäuer Ausweisdokument berappen. Ich überlegte, ob sich so viel Kohle für eine Fahrt, vor der mir ohnehin angst und bange war, überhaupt lohnte. Allerdings: Schon allein wegen der spektakuläre Gratwanderung, die in der Wander-App vielfach angepriesen wurde, schien es ein einigermaßen fairer Deal. Ich zahlte zähneknirschend den gewünschten Betrag und begab mich mit Herzklopfen in die Kabine, schloss die Augen und traute mich nach zwei Minuten, in denen ich ruhig nach oben gezogen wurde, meine Augen einen Spalt breit zu öffnen. Ich lebte noch.
Den Umstieg auf den Sammellift verweigerte ich. Konzentration, Ruhe und Entspannung in einer Menschenmenge, die buchstäblich an einem Seil hing, stellte ich mir schwierig vor. Die letzte Etappe ging ich zu Fuß. Und stellte nach den ersten Schritten fest, dass ich bei der Wasserfallwanderung am Tag zuvor meine Beine einseitig beansprucht hatte und mein führendes Bein vom ewigen Hochgehen der Baumwurzel-Treppen zu nichts mehr zu gebrauchen war.
Diesen harten Aufstieg meisterte ich daher mit meinem linken Bein, kam mit dieser Hinketechnik meinen ersten echten Berg hinauf. Überstand auch die Gratwanderung, die tatsächlich machbar war: rechts und links der grün bemooste und wunderschöne Abgrund, der aber längst nicht so steil war wie im Saarland. Man hätte sich wirklich anstellen müssen, von diesem dann doch recht breiten Weg herunterzufallen. Das schaffte nicht einmal ich, obwohl ich diese Textpassage gern mit einer Cliffhanger-Story aufgepeppt hätte.
Bei der Brotzeit auf dem Berg hörte ich von anderen Gratwanderern, dass der letzte Lift ins Tal um 16.30 Uhr abfahren sollte. Um diese Zeit kam ich in meiner nordischen Heimat erst richtig in die Gänge; hier sollte schon Schicht im Schacht sein. 16.30 Uhr, das war in genau zwanzig Minuten und würde bedeuten, dass ich das Brot jetzt sofort herunterschlingen und den letzten Kilometer wieder auf den Berg hinauflaufen müsste. Wollte ich das wirklich?
Ich blieb sitzen. Würde ich diesen Berg halt zu Fuß wieder hinabgehen. Was waren schon 1200 Höhenmeter, wenn ich frisch gestärkt war und euphorisiert von der coolsten Wanderung meines bisherigen Wanderlebens? Ich machte mich an den Abstieg, telefonierte mit der Heimat, bis die Verbindung abriss. Dann gab es nur noch mich und das Fellhorn. Rhythmisch wippend ging ich weiter, zählte die Kurven, die ich nahm: Seit dem Telefonat waren es acht gewesen. Ich trottete mit elastischem Schritt den breiten asphaltierten Weg hinunter und hätte gern jemanden gefragt, wie weit es noch sei. Allein hier war niemand.
Um die nächste Kurve biegend, sah ich das Tal. Geschafft! Ah nein, doch nicht, es war die Mittelstation. Leere Kabinen drehten ihre Runden. Ich schaute aufs Handy: 17.00 Uhr. Doch da unten arbeitete noch jemand, überwachte die Kabinen. Ich nahm meine Beine in die Hand, lief den Berg herunter, winkte der Dame zu, ob sie mich noch mitnehmen könne. Ja, ja, ich solle meine Karte in den Automaten stecken. Ach du Sch… Die Karte, die ich eigentlich heute nicht mehr brauchen sollte. Wo war sie?! Ich durchsuchte meine Hosentaschen, die Seitentaschen meines Rucksacks: Da! Schob sie mit zitternden Fingern in den Schlitz und wurde hineingelassen. Die Abfahrt gestaltete sich fast schon easy; bereits nach einer Minute öffnete ich meine Augen, schaute hinaus auf die sanften hellgrünen Hügel und war trotzdem heilfroh, als sich die Kabinentüren unten tatsächlich auseinanderschoben und ich endlich die Bilder von dem dunkelgrünen Berg mit meinen sozialen Freunden teilen konnte.
Bei der Abreise verlangte man nach meinem Touristenpass.
„Den habe ich gar nicht bekommen!“
Ich erzählte dem Hotelbesitzer die Geschichte von den 27 Euro, ließ meinen Unmut durchklingen und ging. Gerade war ich dabei, meinen Koffer zu verladen, da kam seine Frau herausgelaufen und erklärte mir wortreich, dass ich doch am ersten Abend hätte herunterkommen sollen, um den Pass abzuholen. Was mir natürlich neu war. Sie entschuldigte sich für das Missverständnis.
Unklar blieb: Warum hatte sie mich auf das Zimmer gebracht, wenn ich doch wieder herunterkommen sollte? Ich sah den Sinn nicht. Und offenbar verstand ich den hiesigen Dialekt noch viel schlechter als den Akzent von englischsprechenden Asiaten.
„Wo sind wir denn hier?“, fragte ich die beiden Damen, die mich in dem umgebauten, hochmodernen Bauernhaus empfingen.
„In Oberbayern“, schoss es aus beiden heraus, in einem Dialekt, den ich weder mündlich noch schriftlich wiedergeben kann. Ich war auf der Hut: Es hieß, genau aufzupassen, wenn mir nicht wieder Unannehmlichkeiten begegnen sollten. Herrlich war es hier: weit ab vom Schuss in einem echten bayerischen Dorf mit Zwiebelturmkirche, als einziger Gast. Kackfrech hatte ich mir über das Netz das beste Zimmer reserviert, weil es vom Preis her keinen Unterschied machte: geräumig, blitzblank und mit Terrasse. Hinzu kam die exklusive Betreuung durch die beiden Damen; der Hausherr schlurfte nur einmal am Tag mit einem „Servus“ vorbei. Es fiel den beiden schwer zu begreifen, warum ich ausgerechnet um zehn Uhr frühstücken wollte, wenn es doch rein theoretisch schon ab sieben möglich war. Auch nach der vierten Nacht, die ich hier verbracht hatte, zeigten sie Widerwillen, als ich ihnen für den nächsten Tag mein Erscheinen am Tisch ankündigte. Doch diese moralische Diskrepanz hinderte sie nicht daran, mich mit Topinfos zu versorgen.
„Naaaa, sie müssen doch nicht direkt in München parken.“
Stimmt, ich musste nicht in München parken, vor allem nicht in Anbetracht der Tatsache, dass das Parkhaus dort für einen Tag 25 Euro haben wollte.
„Sie stellen Ihren Wagen einfach am Mangfallplatz ab.“
Zwei Euro fünfzig!
„… und fahren mit der U-Bahn Richtung Innenstadt. Sechs Stationen.“
Der Münchenausflug machte dann doch nicht so viel her, wie ich gedacht hatte – für die sozialen Netzwerke sprang in Oberbayern wenig heraus: kein einziges Foto von der Landeshauptstadt, keins von der Zugspitze und nur bedingt eins von Neuschwanstein – aber dazu komme ich noch. München auf jeden Fall war fade. Und grau – es regnete. Ich gönnte mir eine Hop-on-hop-off-Tour; wenn nichts mehr ging, riss die meist noch etwas heraus. Zu früh gefreut: Kein Ort, der meine Aufmerksamkeit fesseln würde; ich saß die überdachte Tour ab, daddelte auf meinem Handy und freute mich auf die Zugspitze am nächsten Tag.
„Wir hatten neulich zwei Polen hier, die wollten auf die Zugspitze“, erzählte die Tochter beim Frühstück. „Die sind schon um fünf los.“
„Wackere Kerlchen“, dachte ich bei mir und nickte wenig überzeugt. Punkt zehn Uhr erschien ich am Frühstückstisch und trudelte nach einem Latte macchiato, einem Kapitel aus dem Roman, den ich gerade las, einer entspannten Wasch-und-Zahnputz-Runde und einem Stau gutgelaunt gegen 14 Uhr in Grainau ein. Den Mann vom Parkplatz fragte ich nach einem Ticket für die Zugspitze. Der zeigte mir einen Vogel. Ich könnte auf die Alpspitze, meinte er. Alpspitze – nie gehört.
„Aber warum kann ich denn nicht auf die Zugspitze?“ Ich gab nicht auf.
„Wegen Corona. Die Tickets sind begrenzt. Für heute ist Schluss, erst morgen wieder.“
Doch morgen, das wusste Herr Google, sollten es da oben um die 10 Grad werden. Mit Nebel. Übermorgen war ich schon im Berchtesgadener Land. Ich verwarf meinen Zugspitzenplan und fuhr stattdessen zur Rodelbahn. Das Sommerrodeln liebte ich – und hier in Bayern gab es sogar echte Berge! Ich überwand meine Höhenangst und wurde rücklings in einen Sessellift gedrückt – ein Albtraum für Leute wie mich, da diesmal nicht einmal ein Kasten um mich herum war, der wenigstens etwas Sicherheit versprach. Meine Füße baumelten in der Luft; ich hoffte das Beste.
Eine rasante Fahrt folgte, in der ich fast aus der Kurve geschleudert wurde, darauf ein scharfes Abbremsen, weil die zwei Mädchen vor mir sich nicht trauten und ich sie nur ungern über den Haufen fuhr. Ich wartete fünf Minuten ab, ließ die Bremse los, rutschte hinunter bis zur nächsten Kurve, die die Mädchen gerade erreicht hatten. Ab da ging es nur meterweise. Unten angekommen stellte ich mich sofort wieder für den Sessellift an, ließ oben erstmal zehn Minuten verstreichen, bis wirklich alle Ängstlichen vor mir durch waren, und schaffte es über die Piste polternd diesmal ganz bis nach unten.
Meine Pensionswirtin brachte mir am nächsten Morgen einen Flyer vom Märchenwald für große und kleine Kinder bis 12 Jahre, den ich beschämt heimlich in die Tonne auf dem Neuschwanstein-Parkplatz schmiss. Eigentlich gehörte nicht nur der Flyer in die Tonne, sondern mein gesamter heutiger Besuch in den königlichen Gefilden. Beim zähen Heranpirschen an das Objekt der Begierde (keiner hatte mir gesagt, dass es wieder bergauf gehen würde!), entdeckte ich eine Schlange mitten im Wald. Nein, nicht so eine, wie man sie in Australien erwarten würde. Hier stand man an.
Was wollten die Leutchen dort, was war ihr Ziel?
Sie wollten das ultimative Foto schießen, das Foto, das die meisten asiatischen Touristen zu einem Besuch in Deutschland bewegt. Sie hatten vor, Neuschwanstein aus einer besonders guten Perspektive zu fotografieren, von der Marienbrücke aus. Und waren bereit, einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit dafür zu opfern – die Schlange machte mehrere Kurven, und verschwand dann im Nirgendwo. Ich fragte mich, wie lang sie wohl war, wenn Fremde wieder ins Land durften, wenn auch Asiaten und Amerikaner anstanden.
Das Foto, das ich machte, war nicht ultimativ, sondern vom Parkplatz aus aufgenommen. Irgendeinen Beweis, dass ich da gewesen war, brauchte ich schließlich schon. Dafür fotografierte ich die Schlange und schwenke gewohntermaßen auf Plan B um: Ich badete im Walchensee, der ohnehin fotogener war.
Nach Herzenslust fotografieren konnte ich am Abend die mit kirchlichen Motiven bemalten Häuser in Mittenwald, wo ich die ekeligsten „Käsespatzn“ meines Lebens aß. Mehrere Male war ich die Fußgängerzone auf- und abgeschritten, auf der Suche nach einem Tisch. Gar nicht so leicht, denn erstens machte ganz Deutschland gerade hier, am südlichsten Zipfel der Republik, Urlaub. Zweitens durften viele Tische wegen Corona nicht belegt werden. Ich wollte dem einfachen Laden an der Ecke, in dem die Spätzle 6,90 Euro kosten sollten, eine Chance geben. Zwar war der Preis verdächtig, doch was konnte man bei Nudeln schon falsch machen?
Die Antwort: alles. Das Gericht schmeckte so, als hätte man die Reste vom Vorgänger aufgewärmt, dem es auch schon nicht geschmeckt hatte, weil er das vom Vorgänger Aufgewärmte aufgetischt bekam. Ich wartete ewig auf die Rechnung, holte mir noch die obligatorische Kugel Eis und kam erst bei Einbruch der Dunkelheit in Mittenwald los.
Das allerdings stellte sich als fataler Fehler heraus. Zwar wusste ich, dass ich bei Nacht nicht so gut sah, kam in der Stadt aber sonst gut zurecht. Hier, nach dem Herumfahren bei 30 Grad zwischen Neuschwanstein, Walchensee und Mittenwald, ergriff mich nicht nur die Müdigkeit. Sobald ich den Ort verließ, konnte ich nichts mehr erkennen, nur die blendenden LED-Lampen der entgegenkommenden Autos. Ich fuhr auf dieser Straße im Niemandsland, die hier und da plötzlich in eine Kurve überging. Natürlich hatte sich schon bald eine Schlange hinter mir gebildet. Wieder eine Schlange! Ich spürte förmlich den bayerischen Ärger hinter mir, biss meine Zähne zusammen, schlich stoisch weiter, sorgsam darauf bedacht, nicht gegen den nächsten Poller zu fahren, der plötzlich rechts am Rand auftauchen konnte.
Endlich sollte es auf die Autobahn gehen. Ich und die Schlange, wir bogen ab – und ich war orientierungslos. Gleißend helles Licht der abfahrenden Autos, angeleuchtete Straßenschilder, mehrere Fahrspuren. Unklar war, welche ich nehmen musste. Mit 20 km/h fuhr ich auf die Autobahn – und verspürte auch dort keine Erleichterung. Mittlerweile sah es überall gleich aus. Ich heftete mich an einem LKW vor mir und fuhr hundert. Klammerte mich ans Lenkrad, beugte mich vor, bis ich irgendwann wieder abfahren konnte.
Hier, im tiefsten Oberbayern, hatte ich keinen Anhang mehr, keine Schlange hinter mir – niemand verirrte sich hierher. Segen und Fluch zugleich, denn um mich herum war es pechschwarz. Nur mit Mühe konnte ich Straße und Feld unterscheiden. Nach zwei Stunden und 50 Kilometern erreichte ich die Unterkunft und schwor mir, bei meiner Tagesplanung nie wieder so nachlässig zu sein.
Das Wichtigste zum Berchtesgadener Land vorab: Das WLAN funktionierte nicht. Der Provider des Hotels hatte seit zwei Wochen Probleme. So erfuhr niemand von der Außenwelt von meiner kleinen Alpentour. Auf den einschlägigen Websites wurde sie als „leicht“ bezeichnet. Um sich oben auf der Alm, wo es nach frischer Milch und Käse roch, eine Brotzeit gönnen zu können, war allerdings ein längerer Aufwärtsmarsch über unebene Wege zu absolvieren. Zusammen mit einigen Familien, die aus herumspringenden Kindern, rüstigen Omas und Opas mit Trekkingstöcken sowie korpulenten Tanten bestanden, machte ich mich an die Herausforderung. Mal fielen sie zurück, mal wurde ich überholt, meist von jungen Paaren. Jeder, wirklich jeder, war hier unterwegs. Unvorstellbar bei uns im Norden. Da nutzte man bei zehn Treppenstufen bereits die Rolltreppe.
Oben fanden alle wieder zusammen. Der eine genoss sein Bier, der andere nutzte das Plumpsklomit ausgeschnitztem Herz, das hier nicht fehlen durfte, ich zog meine Wanderschuhe aus, um meine armen Füße zu belüften. In Sandalen hier herumzuturnen hatte ich mich dann doch nicht getraut. Ich war so entspannt, dass ich mein Handy einem Fremden übergab, damit er von mir ein Foto vor der malerischen Kulisse machte. Man kam ins Gespräch, tauschte Routen aus, Pläne für die nächsten Urlaube, Geheimtipps.
„Genau das richtige Wetter zum Eisessen“, bemerkte Hansi, als wir wieder unten waren.
„Ja, ein Eis gehört zu meiner Tagesroutine“, lachte ich. „Das mache ich gleich auch noch.“
„Da komme ich mit.“
Klar, warum nicht. Als Alleinreisende freute ich mich immer über Gesellschaft, ob nun von einem buckligen Alten, einem Kind, das mir seinen Teddy zeigte, einer Mitwanderin, die meinen schicken Rucksack bewunderte: Mir waren sie alle recht. Mein Begleiter und ich nahmen Platz in der Eisdiele und unterhielten uns prächtig. Wir unterhielten auch alle anderen mit: Hansi hatte ein ziemlich lautes Organ. Dennoch blieb ich entspannt – wir waren draußen und ich hatte heute einen Haken hinter eine Tour mit Alm und Plumpsklo gemacht.
Von meiner Schokoladenseite musste ich mich zum Glück nicht zeigen; war ja kein Date. Ich konnte es auch gar nicht: Im verschwitzten T-Shirt, mit zerzausten Haaren und Botten an den Füßen war ich nicht die beste Version meiner Selbst. Er war eh nicht mein Typ. So war ich noch entspannter, erzählte einen Schwank nach dem anderen aus meinem Leben, lachte viel. Antwortete, dass ich Lektorin war, erklärte bereitwillig, was das sei, fragte im Gegenzug nach seinem Beruf. Er war Kfz-Mechaniker mit eigener Werkstatt. Natürlich erwähnte ich da, dass mein Wagen bei hoher Geschwindigkeit ruckartige Bewegungen machte, sobald ich anfing zu bremsen, fragte nach seiner fachkundigen Meinung.
„Kann ich so nicht beurteilen. Müsste ich mir mal anschauen.“
Hansi lud sich zu einer Autofahrt ein, nach der er mir erklären würde, was das Problem war. In Wahrheit war es jedoch umgekehrt: Ich erwies ihm einen Gefallen, wenn ich ihn an seinem Hotel absetzte; so konnte er sich die Busfahrt ersparen. Dass er ohne Werkstatt und Hebebühne meinen Wagen reparieren konnte, davon war nicht auszugehen.
Natürlich kam es, wie es kommen musste: Der Wagen bremste auf der Fahrt ordnungsgemäß.
„Sonst ist es anders, ich schwör!“
„Lass mich doch mal ans Steuer“, schlug Hansi vor.
Ich hielt das für keine gute Idee. Andererseits: Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, noch einmal einem Automechaniker zu begegnen, der für lau einen Blick auf meinen Wagen werfen würde? Wobei: Was, wenn er mich entführte? Verschleppte?
Ich hielt an; wir wechselten die Seiten. Mir klopfte das Herz. Noch mehr, als Hansi beim Ausparken eine Vollbremsung machte; er wäre fast in ein vorbeifahrendes Auto hineingerasselt. Dann aber schwang er sich zu Hochtouren auf, beschleunigte auf 100 km/h.
„Sonst bringt es nichts mit dem Bremsen!“, rechtfertigte er sich.
Ich schrie, bat ihn inständig darum, vernünftig zu sein. Er würde mich nicht verschleppen, sondern auf dieser schmalen Landstraße umbringen. Er machte eine Vollbremsung – der Wagen gehorchte ohne Murren. Hansi drehte um und fuhr auf den Parkplatz seiner Unterkunft. Sofort zog ich den Schlüssel ab.
„Damit wir uns nicht aus Versehen aussperren“, quittierte ich beim Aussteigen, traf ihn am Kofferraum.
„Wir könnten ja Nummern tauschen und mal zusammen wandern …“
„Ja, warum nicht“, meinte ich und diktierte meine Nummer.
„Oder möchtest du heute bei mir übernachten?“
Oha. Die Entspannung wich von mir.
„Dann bräuchtest du nicht zurückzufahren …“
Ich stieg ins Auto, drückte aufs Gaspedal, bog quietschend auf die Landstraße, hinter mir hupte es. Ich gab Gas, umklammerte das Lenkrad. Bloß weg hier. Und ja keine Kurve der Alpenstraße schneiden. Das Adrenalin wurde durch meine Adern gepumpt. Angespannt und hochkonzentriert raste ich weiter. Die erste Möglichkeit zum Halt kam dreißig Minuten später. Mit zitternden Knien stieg ich aus, holte das Handy aus dem Rucksack, blockierte Hans‘ Nummer im Messenger. Trank etwas. Bestieg wieder das Auto, fuhr diesmal ruhiger. Jetzt, da der Wagen wieder normal bremste, wäre es ja ideal, wenn ich heil am Ziel ankam. Ich atmete tief durch, wagte es nicht, Musik einzuschalten.
Seine SMS kam am Abend. Dieser gerissene Hund. Geistesgegenwärtig war Hansi auf die alte Kommunikationsform ausgewichen, die ich in der Hektik nicht auf dem Schirm gehabt hatte.
„Hallo Andrea, irgendwie funktioniert WhatsApp hier nicht. Ich fand den Tag sehr schön, würde ihn gern wiederholen. Vielleicht morgen bei einer kleinen Wanderung?“
Ich packte das Handy weg.
Beim Frühstück klingelte es, Hansis Nummer im Display. Entschuldigend schaute ich in die Runde, ließ die Melodie weiterdudeln in der Hoffnung, dass bald Ende wäre. Irgendwann hörte es auf. Er probierte es am Abend noch zweimal. Dann eine Woche später, als ich wieder in Hamburg war. Inzwischen hatte ich seine Nummer als Spam markiert, er aber rief vom Festnetz an, irgendwo aus Baden-Württemberg.
Ich unterdrückte den Anruf und hielt das erneute Klingeln, im Wohnzimmer sitzend, aus, war hart im Nehmen. Er allerdings auch. Er versuchte es noch drei Monate von verschiedenen Nummern aus, schickte immer wieder SMS, in denen er an unsere tolle Unterhaltung im Berchtesgadener Land anknüpfte. Die Nachrichten landeten im Spamordner. Erst als ein Kumpel, der gerade zu Besuch war, an mein Handy ging, kam die entscheidende Wendung.
„Du kennst keine Andrea, hast diese Nummer gerade erst zugeteilt bekommen“, zischte ich ihm zu, als ich ihm mein Smartphone übergab.
„Hier ist keine Andrea“, sagte Karl ruhig, als mein Lieblingsstalker seine einleitenden Worte gesprochen hatte.
„Das ist komisch.“
Hansi erklärte, dass er oft versucht hatte, mich zu erreichen. Mein Retter zeigte sich verständnisvoll, konnte aber nicht weiterhelfen. Da verstand der Typ es endlich.
Von nun an hatte ich Ruhe.

Hier im Berchtesgadener Land wollte ich meinen Touristenpass definitiv ausnutzen und steuerte auf die Rauschbergbahn zu. Nach zwei Tagen, in denen ich mit mir gerungen hatte, stand mein Entschluss fest: Ich würde in diese einzelne gelbe Gondel steigen, die in schwindelerregender Höhe an nur einem Seil in der Luft schwankte, allen meteorologischen Widrigkeiten ausgesetzt, die ich mir bildhaft ausmalen konnte. Dagegen waren die anderen Seilbahnen, die dicht am Berg entlangfuhren, ein Klacks. Mir war nicht klar, wie ich mit der Panik in der kleinen Kabine umgehen sollte – das würde ich mir dann überlegen.
Oder auch nicht – gleich bei der Zufahrt zum Parkplatz sah ich ein Schild: Bahn wegen starker Windböen geschlossen. Ich googelte schnell, wo ich meinen Touripass noch einsetzen konnte, entschied mich für eine weniger spektakuläre Seilbahn, in der der starke Wind durch die oberen Fenster pfiff und wo nicht klar war, ob wir auch wieder heruntergebracht würden. Ein Vater strich seinem Sohn beim Hinauffahren über den Rücken, redete ihm gut zu. Dieser hatte seinen Blick auf den Boden geheftet. Wie ich. Nur dass ich noch genug Lockerheit besaß, die Wanderschuhe der Mitgondler zu mustern, sie mir genau einzuprägen.
Auch wenn ich die Fahrt nach unten, die leider meist dazugehörte, gern vermieden hätte, musste ich auf dem Rückweg das Seilbahnprozedere wieder mitmachen; die Zeit drängte. Unten wurde ich nach der überstandenen Gefahr immerhin mit einem Schub Glückshormone belohnt: Ich hatte es überstanden, das Abenteuer Seilbahn. Hastig fuhr ich weiter in Richtung Bayerischer Wald.
Langsam hatte ich den Dreh raus beim Zimmerfinden, nächtigte statt im teuren Passau lieber in Neuburg – was nicht zufällig so hieß: Ich wohnte in einer bezahlbaren Burg mit weißem Gemäuer. Und frühstückte am Morgen auf einer Bank im Schlossgarten, ein Sandwich in der Hand, während die ersten Besucher die Gartenanlagen besichtigten. Irgendwie fühlte ich mich in meiner Privatsphäre gestört, war es doch meine Butze hier, wenn auch nur für zwei Nächte.
Die letzte geplante Hikingstrecke im Bayerischen Wald wanderte ich lustlos ab – langsam war der Ofen aus –, kam an zwei schroffe Felsen: die Rauchröhren. Ein Mann Ende Dreißig schickte sich an, sie zu erklettern. Hochkonzentriert und präzise platzierte er seine Finger, zog sich nur anhand seiner Muskelkraft in den Fingerspitzen und Armen hoch. Seine Füße ertasteten blind den nächsten für mich kaum sichtbaren Vorsprung. Ich setzte mich prompt hin, um das Spektakel aus einer bequemen Position zu verfolgen. Seine Frau, die unten assistierte, war entspannt, andere Wanderskinder fieberten genauso mit wie ich und jubelten, als er endlich oben angekommen war.
Es nützte nichts: Ich musste weiter und sollte nun, an der nächsten Weggabelung, vor allem entscheiden, wo ich langgehen wollte. Offenbar war für mich der Weg zwischen den Rauchröhren vorbestimmt. Dort kletterte gerade ein Dreiergespann unter Zuhilfenahme von Händen und Füßen hinunter. Nicht ganz so spektakulär wie beim Sportler eben – dennoch sah die Strecke nach Schürfwunden und verrenkten Knöcheln aus. Ich beschloss, dass ich auf dieser Reise genug Eindrücke gesammelt hatte, und nahm den simplen Weg zurück.
Im Passauer Restaurant, das ich dennoch zur Belohnung aufsuchte, verstand ich endlich, warum so viele Bayern eine Wampe hatten. Von den Speisen auf der Karte sprach mich am meisten der Wurstteller an.
„Sind das so kleine Würste?“, fragte ich die Kellnerin. Vor meinem inneren Auge sah ich fingergroße Nürnberger Würstchen, die es im Zwölferpack gab.
„Nein, mittlere.“
Was auch immer das heißen sollte.
„Kann ich das als kleine Portion bekommen?“
Sie schüttelte den Kopf.
Ich ließ es darauf ankommen. Aufgetischt wurden mir vier Prachtexemplare: eine dickbäuchige Weißwurscht, eine Frankfurter, eine Rostbratwurst und eine Wiener. Dazu ein kleiner Leberkäse und ein Berg Bratkartoffeln. Mit Sauerkraut. Das Ganze für 12,95.
Die Völlerei stellte sich als gute Vorbereitung für meinen letzten Urlaubsabend heraus, den ich auf einer Restaurantterrasse über den Dächern von Passau verbrachte. Dort fragte mich die Kellnerin, ob ich mich wirklich in die Corona-Nachverfolgungsliste eintragen würde – sonst bekäme ich kein Besteck. Ich schrieb was hin und bekam ein Wiener Schnitzel serviert, das über den Tellerrand hinausragte und sich kaum bändigen ließ. Plus die obligatorischen Kartoffeln, ungefähr ein halbes Kilo. Dazu Salat. Um meinem Vorsatz, jeden Abend mit einem Nachtisch zu beenden, treu zu bleiben, bestellte ich zum Abschluss eine Eisschokolade und rief, sobald auch die vertilgt war, schnell nach der Rechnung. Eine Übelkeit stieg in mir hoch. Mit bedächtigem Schritt ging ich zurück zum Wagen, öffnete meinen Hosenknopf und fuhr nicht schneller als 30 km/h, damit es nicht so wackelte – und weil ich zu nichts anderem in der Lage war. Ich konzentrierte mich auf die Strecke, die zur Burg zurückführte und über die sich langsam die Nacht legte. Konzentrierte mich auch darauf, mich nicht zu übergeben.
Die 850 Kilometer zurück nach Hamburg absolvierte ich in 12 Stunden. Eingerechnet waren die Frühstücks-, Mittags- und diverser Abendbrotpausen, wobei diesmal das Abendbrot ausfallen sollte. Nach 20 Uhr waren alle Raststätten coronabedingt geschlossen. Als wenn die Krankheit nachts aus den Löchern kriechen würde. Als ob der Reisende während der Pandemie abends keinen Hunger hatte. Ich ließ das Abendbrot also ausfallen – es konnte nicht schaden, die sechs Kilo, die ich während meines Besuchs im Süden zugenommen hatte, sofort anzugehen.
Reist du gern? Wie wäre es dann mit Osteuropa?
Ich liebe Flöhe, Flöhe
Ballaballamann
Oder doch lieber in die Stadt der Liebe?
Pipi in Paris
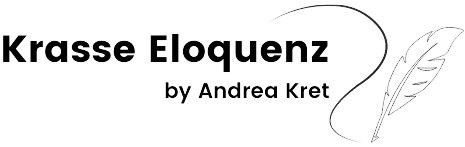



Pingback: Ich liebe Flöhe, Flöhe - Krasse Eloquenz