Es gibt keine europäische Sprache, die ich mir nicht irgendwie herleiten könnte. Spanisch und Portugiesisch sind dank meiner Französisch- und Italienischkenntnisse ein Klacks, auch wenn die Bedienung in Lissabon das anders sah. Sie konnte die simple Transferleistung vom italienischen „prosciutto“ zu dem mir damals noch unbekannten portugiesischen „presunto“ beim Bestellen eines simplen Omeletts mit Schinken nicht vollbringen. Und ich hätts so gern gegessen.
Bulgarisch war easy, wenn ich Polnisch und zwei Semester Serbokroatisch an der Uni zusammenschmiss. Mit Tschechen konnte ich mich ganz normal unterhalten: ich auf Polnisch, sie auf Tschechisch. Sie verstanden mich, ich sie. So einfach war das.
Die skandinavischen Sprachen waren wegen des Deutschen und Englischen ein Selbstläufer.
Allerdings gab es vier Sprachen in Europa, bei denen ich passen musste. Die eine versuchte ich zu beherrschen, indem ich mir einen albanischen Freund anschaffte, Pardon: mazedonischen, aber in der Gegend sprach man Albanisch. Einen Freund mit dem ansprechenden Hobby des In-Cafés-Abhängens. Drei Stammcafés waren es, um genau zu sein, die er in wechselnder Reihenfolge aufsuchte. Mit ihm klappte die Kommunikation wunderbar: Wenn ich von Flugzeugen sprach, genügte eine gleitende Handbewegung nach oben, schon begriff er. Viel Albanisch vermittelte er mir nicht – außer „Të dua pa mbarim“, „Ich liebe dich unendlich“. Ein Anfängerkurs an der Volkshochschule hätte es getan oder ein Strukturkurs Albanisch an der Uni; doch die Nachfrage nach der so unendlich poetischen Sprache hielt sich in Grenzen.
„Biztonságtechnikai“ – ein Begriff aus einer weiteren Sprache, bei der ich völlig ahnungslos war. Bei uns sagte man dazu unkompliziert „Sicherheit“. Dass ich den Zusammenhang zwischen beiden Wörtern nicht sah, bereitete mir als Allroundlinguistin etwas Sorgen, jedoch nicht so viele, dass ich mir die Sprache, in der ich nur „Gulasch“ kannte, hätte aneignen müssen. Damit hatte sich für mich gleich Finnisch mit erledigt. Die Finnougristik würde ich nicht mit meinem Interesse beehren.
Als mein Arbeitgeber mir einen Sprachkurs in einer exotischen Fremdsprache finanzieren wollte, entschied ich mich für die Unbekannte Nummer vier. Griechisch wollte ich lernen, die Sprache unserer Vorfahren. Endlich würde ich vollends erfassen können, was es mit der Zivilisation und der Demokratie auf sich hatte.
Mit mir erfassen sollten dies sechs weitere Wissbegierige, die ebenfalls im Unterricht saßen und gerade dabei waren, sich, wie es sich gehörte, der Reihe nach vorzustellen. Karl-Heinz hatte die Ambition, am Ende des Kurses die Speisekarte beim Griechen lesen zu können, Gisela wollte bloß nur unter Leute, so schien es mir, gab jedoch einen anderen Grund an. Als ich was von Transkription, strukturellem Aufbau und syntaktischen Grundlagen sagte, machten die anderen ein Gesicht, als hätten sie in eine unreife Olive gebissen.
Die Kursleiterin, Alina, hingegen hatte die Situation im Griff und sprach zur Auflockerung die ersten Sätze auf Griechisch: „Ich bin Alina. Wer bist du?“ Nun, ich war Andrea und konnte trotz meiner so gut wie gar nicht vorhandenen Griechischkenntnisse heraushören, dass Alina, wenn sie Griechisch sprach, einen derben russischen Akzent hatte. Klar, nobody is perfect. Aber ein russischer Einschlag bei einem vermeintlich muttersprachlichen Spezialisten, womit die renommierte, traditionsreiche Sprachenschule auf ihrer Website warb … Ich stellte mir vor, wie ich in einem Jahr mit diesem Akzent eine Portion Souflaki in Karl-Heinz’ Stammrestaurant bestellte und die Kellner vor Lachen unter dem Tisch lagen.
„Nein, das funktioniert für mich nicht“, sagte ich am nächsten Tag zu meinem Chef. „Ich möchte nicht wieder zu Alina. Außerdem hat sie uns in der ersten Stunde gezeigt, wie sie manche Buchstaben schreiben würde. Die Frage, die offen blieb, ist: Wie schreiben sie beispielsweise die Griechen? Nein, ich gehe nicht wieder hin. Njet.“
Die Sprachenschule rief besorgt an, als sie von unserer fristlosen Kündigung erfuhr, und versprach, eine echte Griechin für den Unterricht zu organisieren.
„Sie heißt Antigone“, hieß es verheißungsvoll beim zweiten Telefonat.
Schuldbewusst und dennoch hoffnungsvoll ging ich wieder zum Unterricht. Karl-Heinz war schon da, Gisela – und Alina. Die stützte sich mit beiden Händen auf dem Pult ab und sprach in tragödienreifem Ton: „Jemand hat mich verpetzt. Wer?!“
Es war nicht die Taktik, die Columbo wählen würde, um sich der Wahrheit zu nähern. Ihr lag eher die direkte Herangehensweise. Karl-Heinz war empört. Nein, er hätte nichts damit zu tun, er wolle ja nur in seinem Restaurant … so eine Frechheit. Gisela schien ratlos. Ich fixierte unauffällig einen Punkt an der Decke.
Während sich die kleine Versammlung dranmachte, den Verräter zu finden – und zeitgleich von Alina abgeworben wurde –, beobachtete ein Mädel, das neu hinzugekommen war, die Gruppe mit verwirrtem Gesichtsausdruck. Dahinter jemand, der Antigone sein könnte. Antigone, die von der Sprachenschule offenbar nur unzureichend über das hier aufgeführte Drama informiert worden war, was Alina schnell nachholte, dabei diskret das geplante Tête-à-Tête mit den anderen Teilnehmern verschweigend.
Antigone hörte geduldig zu und sagte das einzig Vernünftige in dieser Situation: „Ich bin Antigone und soll hier Griechisch unterrichten.“ Mit einem einwandfreien griechischen Akzent. Karl-Heinz erhob sich, Gisela und den Rest der Gesellschaft im Schlepptau. Übrig blieben ich und die junge Frau, die ratlos zugab: „An sich wollte ich schon richtig Griechisch lernen.“
Von nun an bestand unsere Gruppe aus zwei Personen – und wurde nach sechs Monaten mangels Teilnehmer aufgelöst. Doch was wir mitnahmen, nahmen wir mit.
Den zweiten Versuch machten meine Kollegin Tina und ich zusammen mit unseren beiden Vorgesetzten, Reinhard und Brigitte. Ein Chinesisch-Crashkurs an der Volkshochschule sollte es werden. Weil wir immer noch nicht dahintergekommen waren, ob man im Chinesischen in ganzen Sätze sprach oder sich dort für eine vollkommen andere Lösung entschieden hatte. Bei den Asiaten war alles möglich. Gespannt warteten wir auf das Erscheinen der Chinesischlehrerin und begegneten im Klassenraum Karl-Heinz und Gisela, nur dass sie diesmal Peter und Elke hießen. Peter sagte nichts von irgendwelchen Speisekarten, wollte am Ende des Kurses aber wenigstens auf Chinesisch „Ich liebe dich unendlich“ sagen können. Elkes Motivationen wurden klar, als sie in der Vorstellungsrunde „Och, nur so“ sagte. Wir Linguisten fielen bei unserer Eigenvorstellung negativ auf, aber das waren wir gewohnt. Mit vier Störenfrieden wird man nicht so schnell fertig wie mit einem, allerdings erledigte sich die Sache dann doch von selbst.
Nach einem allgemeinen Gespräch über die besten Chinesen in der Stadt und über die Hotelpreise im Land offenbarte uns die Lehrerin – I Ging hieß sie, wenn ich mich recht entsinne –, dass es im Chinesischen vier Tonhöhen gab: steigend, fallend, fallend-steigend und gleichbleibend. Aha!
Anhand des Wortes „ma“ führte sie es gleich vor, indem sie es viermal unterschiedlich aussprach und jedes Mal ein anderes Wort von sich gab: Mutter, Hanf, Pferd und sogar schimpfen. Elke war überfordert, und ein Nerd aus der ersten Reihe erkundigte sich, wie es hieß, wenn die Mutter sauer war, wenn man zu viel gekifft hat und verbotenerweise auf der Straße auf einem Pferd unterwegs war. Um seine Frage zu beantworten, ließ I Ging uns aufstehen. Wir sollten die Bedeutung der Wörter am eigenen Leibe erfahren.
Die Stühle wurden an die Tische herangerückt. Wir gingen im Gänsemarsch langsam hintereinander um die Tischreihen und warfen beim ansteigenden „má!“ die Hände in die Höhe. Beim gleichbleibenden Ton taten wir gar nichts, gaben ein möglichst ausdrucksloses „ma“ von uns. Beim absinkenden „mà“ hingegen stampften wir mit den Füßen. Es war wie eine Erlösung.
Die Lehrerin wollte zum fallend-steigenden Ton übergehen, da hob meine Chefin Brigitte die Hand: „Könnten wir eine Pause machen?“
Unwillig ließen sich die anderen Teilnehmer, die gerade so schön in Schwung waren, in die Pause entlassen. Brigitte aber hatte Recht: Die ersten zwei Stunden waren um. Es war allerhöchste Zeit für eine Pause.
Im Flur kam meine Chefin gleich zur Sache und sagte zu Reinhard: „Ich halte das nicht länger aus. Ich geh nach Hause.“
Er wollte etwas einwenden, da schob sie hinterher: „Du willst doch nicht, dass ich jemanden erwürge.“
Selbstverständlich konnte Reinhard so etwas nicht zulassen.
Dies war der Augenblick! Oder war es zu frech zu fragen, ob ich mitkönne – bevor wir in der nächsten Runde über Tisch und Stuhl stiegen. Immerhin hatte man mir und Tina die Fortbildung finanziert – und im Voraus bezahlt.
In der nächsten Eckbar kippten Brigitte und ich eine Flasche Sangria hinunter, ließen jede ein Gläschen Sherry nachkommen, als Reinhard und Tina dazustießen. Auf die Speisekarte wartend, bekamen wir von ihnen die Essenz des Kurses als Fünf-Minuten-Supercrash-Version präsentiert und waren nun alle auf dem gleichen Stand, má!
Den letzten Versuch, mich sprachentechnisch fortzubilden, unternahm ich bei meinem neuen Arbeitgeber Tradolingua, der auf dem internationalen Parkett unterwegs war und Wert auf kosmopolitische Mitarbeiter legte. Ein Japanisch- und ein Arabischtrainer wurden nacheinander eingeladen: für einen kurzen, aber gehaltvollen Überblick über ihre Sprache, in jeweils drei Gruppen.
Der Japanischtrainer verlor durch mich das Gesicht; ich weiß schon gar nicht mehr, warum.
Der Arabischmensch hatte das Pech, beim zweiten Durchgang ausgerechnet mich und meinen Übersetzungskollegen Konrad dasitzen zu haben. Konrad wollte es genau wissen, stellte Fragen, die mit „Habe ich das richtig verstanden …?“ begannen. So wie: „Habe ich das richtig verstanden, dass die Araber einen Satz erst linguistisch analysiert haben müssen, um ihn vorlesen zu können?“ Oder: „Habe ich es richtig verstanden …“ – und dann irgendwas Geschichtliches, das auch ich nicht richtig verstanden hatte. Und auch sonst niemand. Aber wer wird da gleich nachhaken …?
Ich hingegen war eher für die „Und wie ist es mit“-Fragen zuständig.
„Und wie ist es mit der Verbstellung im Satz?“
„Und wie ist es, wenn ein Otto-Normal-Araber mit Hauptschulabschluss, ohne linguistisches Wissen eine Zeitung zur Hand nimmt?“
In den Gesichtern der anderen Sprachschüler erkannte ich, dass ich etwas politisch Unkorrektes (aber sprachlich Relevantes!) gefragt haben musste. Selbst Konrad guckte komisch. Wir überzogen um eine Viertelstunde, während die Kollegen vor uns zwanzig Minuten eher in die Pause getürmt waren.
Zum Sprachunterricht gehe ich nicht mehr. Stattdessen habe ich beschlossen, mich beim nächsten Mann an einen Usbeken zu halten – die Sprache soll faszinierend sein.
Jetzt aber mal ernsthaft! Wenn dich das Thema Sprachenlernen interessiert, findest du hier ein spannendes Interview:
„Man muss jede Sprache anders lernen“
Und hier geht es zum Interview mit einem Deutschen, der seit fast 40 Jahren in China lebt: „Wie im Paradies“: Herr Müller in China
Und dann fehlen natürlich noch die China-Satiren:
Pekingente, pikant
„Schweinegrippe“
„Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie?“
„Ein Schlüsselerlebnis“
Titelfoto: © iStock/cybrain
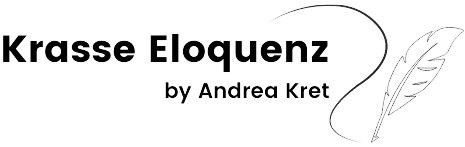



Pingback: „Man muss jede Sprache anders lernen“ – Krasse Eloquenz
Pingback: Schweinegrippe – Krasse Eloquenz
Pingback: Wo bitte geht es hier zur Teezeremonie? – Krasse Eloquenz
Pingback: „Wie im Paradies“: Herr Müller in China – Krasse Eloquenz
Pingback: Ein Schlüsselerlebnis – Krasse Eloquenz