Du möchtest diese Satire lieber hören? Von einem grandiosen Sprecher eingesprochen? Hier geht’s lang.
Sie tat es ohne Vorwarnung, auf die feige Art. Als ich abends von der Arbeit kam, lag ein Zettel auf dem Tisch: „Andrea, das mit uns hat keinen Sinn. Ich gehe.“ Und dann noch irgendwas davon, dass in meiner Wohnung alles so alt sei.
Um von seiner Putzfrau verlassen zu werden, muss man eine gehabt haben, genau. Nein, ich bin nicht reich. Ich bin bloß als Studentin in diese Wohnung gezogen und sah mich bereits von Anbeginn mit folgenden Tatsachen konfrontiert: Die Tür vom Bad schloss nicht richtig, dort gab es kein Fenster und auch keinen Abzug – egal. Die einfach verglasten Scheiben im Wohnzimmer waren so dünn, dass es sich im Winter wie in Sibirien anfühlen würde – nicht so schlimm. Der Ikea-Teppich reichte nur bis zur Hälfte des Raumes, weil vorausschauendes Kaufen nicht so mein Ding war und sie den Teppich anschließend nicht mehr auf Lager hatten – kein Drama, das würde ich überstehen. Ich wollte in dieser Kleinstwohnung ohnehin nur kurz bleiben. Daraus wurden zwölf Jahre, und auch dann ging ich erst, als der Vermieter mich wegen Eigenbedarf rausschmiss. Sein Sohn käme aus China zurück und hätte gern was zum Wohnen. Dieser Sohn berichtete mir später, dass der Bunker direkt neben dem Gebäude zu einem High-Class-Wohnbau umfunktioniert würde. Jeden Morgen hörte er die unscheinbare Tröte, die eine erneute Explosion ankündigte. Passanten wurden an der Straße angehalten, der Verkehr kurzzeitig lahmgelegt, weil man zwei Wände des Bunkers sprengte. Man wollte den künftigen Bewohnern ein paar Fenster gönnen. Dafür musste die altehrwürdige Firma Amadeus Schliemann weichen, die mich zwölf Jahre meines Wohnens dort begleitet hat. Kein Ausblick mehr auf Sand und Baustoffe, kein Scheinwerfer, der in aller Herrgottsfrühe in mein Fenster schien, keine Motorsägearbeiten um 6 Uhr morgens, wenn ich mitten in meiner REM-Phase war.
Doch kommen wir zurück zu den Anfängen: Ich war in diesem Zuhause quasi auf dem Sprung, wollte gleich wieder weg. Wer wird denn da groß putzen, das Fett von der Asbach-Deckenlampe schaben (wie es dorthingekommen war, bleibt mir bis heute ein Rätsel), wer wird zu tiefe Einblicke ins Klo gewinnen wollen? Ich gewöhnte mir eine unbekümmerte Einstellung an und ließ nach dem vierten Jahr einfach niemanden mehr in meine Wohnung – oder maximal bis ins Wohnzimmer. Die Küche erklärte ich zur Tabuzone, Zutritt nur in Ausnahmefällen und bei gedimmten Licht. Irgendwann begann man sich in meinem Freundeskreis zu wundern, dass ich jedes Mal aufsprang, wenn jemand etwas im Hausmüll entsorgen wollte („Lass mal, ich mach das schon!“). Es war an der Zeit zu handeln. Ich wurde ganz dekadent – man lebt nur einmal – und bestellte für meine Ein-Zimmer-Wohnung über Bekannte eine Reinigungskraft, eine echte und wahrhaftige. Ihr Auftrag: Mein Heim sollte noch vor Weihnachten wohnlich werden; das große Wohnzimmer könne sie vernachlässigen und solle ihren Fokus auf die Küche legen.
Gesagt, getan.
Bereits zwei Stunden nach Arbeitsbeginn erhielt ich einen Anruf im Büro, von meinem eigenen Telefon: Liane, so der Name der Putzfee, die meine Wohnung verwandeln sollte, hätte die Lage unterschätzt. Das jahrhundertealte Fett ließe sich nicht so einfach vom Küchenboden schrubben, sie würde die doppelte Zeit benötigen. Da übertrieb sie natürlich ein wenig. Das Fett war nicht seit hunderten von Jahren dort, sondern höchstens seit zehn. Ich ließ das Argument trotzdem gelten. Und, ach ja, sie hätte meine japanischen Slipper angezogen, um nicht barfuß auf der Fettschicht auszurutschen.
Die Slipper wanderten am Abend direkt in den Müll, weil von allen Seiten eine undefinierbare dunkle Masse an ihnen klebte. Dass sie eine meiner Tütensuppen gegessen hatte („Unvorhergesehener Hunger!“), vergab ich ihr ebenfalls und hätte ihr dankbar auch noch die Hand geküsst, als die Schränke beim Aufmachen nicht mehr so doll am Griff klebten.
Liane wurde zu einer festen Institution in meiner Wohnung, kam alle zwei Wochen und sollte sie in fünf Stunden auf Vordermann bringen. Und wenn ihr noch Zeit blieb, führte sie weitere Schönheitsreparaturen aus. Die besagten Küchenschränke mit den roten 50er-Jahre-Griffen sahen zum Beispiel so angegrabbelt aus … Liane hatte da gleich einen kreativen Vorschlag und sagte was von einer Möbeltapete, die sei total einfach anzubringen. Ich gab bei ihr eine neutrale Möbeltapete in Auftrag und ging zur Arbeit.
… um bei meiner Rückkehr festzustellen, dass die Schränke mit einem Bambus imitierenden Muster von nicht näher definierbarer brauner Farbe beklebt waren – die Illusion wirkte aus 100 Metern Entfernung fast perfekt. Weiß hätten sie nicht gehabt, schrieb mir Liane per SMS. Und aufgrund meiner japanischen Latschen hätte sie bei mir eine Affinität zum asiatischen Raum vermutet. Und ob es okay sei, dass sie von meinem Pi-Lo-Chun-Tee getrunken hätte. Sie sei plötzlich so durstig gewesen.
Ich kam gut klar mit Liane. Meine Hütte ließ sich sehen. In fünf Arbeitsstunden vollbrachte Liane für steuerfreie 50 Euro auf den 29 Quadratmetern wahre Wunder. Das sah mein damaliger Freund Marwin anders. Marwin war das, was man wohlwollend als Lebemann bezeichnete. Ich glaube, er hatte seit seinem dreißigsten Lebensjahr keinen Job mehr gehabt. Und das war schon ein Weilchen her. 22 Jahre, um genau zu sein. Nun hatte Marwin in seinem einzigen Job, den ich mal bei ihm herausgehört hatte – als Manager in einem Reinigungsunternehmen nämlich (hört, hört!) –, gelernt, was richtiges Putzen sei. Er zeigte mir die kritischen Stellen an der Badgarnitur, sagte was von Kennerblick und empfahl mir gleich das passende Reinigungsmittel. Auch wenn er nicht viel Gutes in mein Leben gebracht hat; immerhin hat er bewirkt, dass ich ein klärendes Gespräch mit Liane herbeiführen würde. Ich wollte vor ihm doch nicht als „Dummkopf“ dastehen, der „sich Geld aus der Tasche ziehen lässt, während die Putzfrau drei Stunden in der Wohnung in der ‚Aktuellen‘ las“.
Mir war nicht klar, wie ich an diese Konfrontation herangehen sollte. Wo setzte man an? Wie direkt sollte es werden? Oder sollte ich lieber blumig umschreiben? Ich schrieb Liane einen Brief, den ich vor Verlassen der Wohnung auf den Tisch legen wollte. Leider erwischte sie mich an diesem Tag im Bett, dank Amadeus Schliemann und seines neu angeschafften Baggers auf dem Hof schon in wachem Zustand. Ich bereitete ihr keine Umstände und verließ eilig, ohne mir die Zähne zu putzen, die Wohnung.
Zwei Wochen später war es so weit: Diesmal wollte ich mannhaft sein und wartete auf Liane. Ich erzählte ihr von meinem Freund, der die Wohnung nicht ganz so sauber fand. Ich wüsste zwar nicht genau, was er meinte, gab nur wieder, dass er vom hygienischen Zustand der Wohnräume nicht ganz so überzeugt sei. Oder so ähnlich. Und es wäre echt toll, wenn sich da was machen ließe. Den Ausgang kennen Sie: ein Schlüssel auf dem Wohnzimmertisch, daneben der handgeschriebene Trennungsbrief, den ich abends fassungslos in den Händen hielt. Sie hats nicht einmal persönlich gemacht …
Titelfoto: © iStock/Kladyk
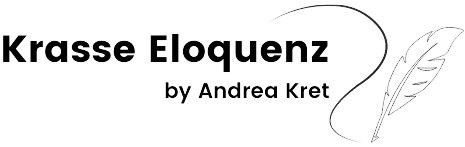



Pingback: Politisch? Korrekt! – Über die Gratwanderung beim Improtheater, über Abstürze und Höhenflüge – Krasse Eloquenz