Kein Problem, sagt Miriam Palm. Sie hat den Kontinent nicht nur in Vorlesungen und Seminaren an der Uni erkundet, sondern direkt vor Ort. Immer wieder. In diesem Gespräch erzählt sie uns von ihrer Liebe zu Kenia – und zu Norwegen.
Als ich mir deine Website angesehen habe, war ich im positiven Sinne erschlagen, weil ich wusste, dass ich dir nicht alle Fragen werde stellen können, die mich interessieren.
Du warst in Äthiopien, Botswana, Ghana, Kenia, Namibia, Sambia, Simbabwe, Tansania, Togo – nur um einige Länder zu nennen, die du bereist hast. Das liest sich beeindruckend. Davon träumen viele – oder zumindest ich. Wie kommt es, dass du es auch wirklich gemacht hast? Und das mit 36 Jahren.
Als Jugendliche haben mich die Natur und die wilden Tiere in Afrika sehr gereizt, also habe ich, als ich erwachsen war, erstmal mit einem Land angefangen. Da mir das gefallen hat, sind es immer mehr Länder geworden. Je häufiger ich in Afrika unterwegs bin, desto mehr Länder erscheinen auf meinen Radar.
Haben wir Europäer ein verzerrtes Bild von Afrika?
Komplett. Bei meiner ersten längeren Reise bin ich in mehreren Monaten von Kenia per Landweg durch vier Länder nach Namibia gereist. Da habe ich gemerkt, dass ich totale Lust habe, diesen Kontinent besser zu verstehen. Zu verstehen, warum er ganz anders ist, als ich es immer mitbekommen habe. Genau deshalb habe ich afrikanisch-europäische Beziehungen studiert.
Wie sah denn dein damaliges Bild von Afrika aus und wie hat es sich mittlerweile gewandelt?
Die verschiedenen Medien, die wir konsumieren – Nachrichten, soziale Medien, Romane, Sachbücher, Filme – transportieren das Bild von einem sehr armen Kontinent, auf dem es viele Krankheiten gibt und wo gefährliche Tiere leben. Nicht die großen Tiere, für die man hinfährt, sondern Moskitos und Schlangen beispielsweise. Die Menschen in Afrika leiden Hunger, heißt es. Es gibt dort viel Kriminalität. Ein Kollege von mir meinte, Afrika sei so etwas wie ein undurchdringbares Gebilde.
Dem gegenüber steht das romantisch-kolonialisierte Bild von weitläufiger Landschaft, wilden Tieren, nackten Menschen, die den ganzen Tag tanzen, Hütten im Busch. Mir war schon klar, dass es auch Städte gibt, allerdings wusste ich nicht, wie stark die Kontraste sind.
Das Bild, das man hat, ist durchaus realistisch – aber es ist nur ein kleiner Teil vom Gesamtbild.
Das heißt, da ist noch mehr?
Genau. Natürlich gibt es Menschen, die im Busch leben, aber das sind nur wenige. Es gibt auch Krankheiten, aber die sind nicht in jedem Land gleich weit verbreitet. Jeder Staat hat seine eigenen Probleme und gesellschaftlichen Herausforderungen. Das ist mir bewusst geworden, als ich zum ersten Mal da war.
Der Kontinent ist riesig und umfasst 54 Länder – so viele wie kein anderer. Deshalb kann man nicht nur sagen: „Ach ja, Afrika ist arm und hat Hunger. Und wilde Tiere gibt es auch.“ Das lässt sich so nicht zusammenfassen.

Erzähl doch gern von einem Land, das dir besonders am Herzen liegt.
Die meiste Zeit habe ich in Kenia verbracht. Seit 7 Jahren bin ich dort immer wieder für ein paar Monate am Stück. Das Land ist auch ein gutes Beispiel für das, was ich eben beschrieben habe, weil es eine Safari-Destination ist mit einem unfassbaren Wildlife. Darüber hinaus ist es wegen der schönen Strände am Indischen Ozean ein beliebtes Reiseziel.
Das Besondere an dem Land ist, dass die wilden Tiere überall sind. Nairobi ist die einzige Hauptstadt mit einem eigenen Nationalpark. Da kommen einem in der Stadt schon mal Zebras entgegen.
Die laufen dann über den Zebrastreifen?
Gewissermaßen. Der Nationalpark ist einfach Teil der Stadt. Wenn da zur Stadt hin ein Loch im Zaun ist, kommen einem auf der Autobahn auch mal Zebras entgegen. Ansonsten ist es aber eine ganz normale Großstadt, mit Hochhäusern, Banken, zahlreiche Menschen in Anzügen, Freibädern.
Viele denken, dass es in Kenia heiß sei. Es gibt tatsächlich solche Gegenden, aber in Nairobi herrschen nachts auch mal Temperaturen um den Gefrierpunkt, weil die Stadt ziemlich hoch liegt, genau wie Adis Abeba in Äthiopien.
2017, als ich das erste Mal länger in Kenia war, habe ich morgens eine Freundin getroffen – sie ist Teilnehmerin des Projekts, bei dem ich tätig bin. Damals lebte sie mit fünf Kindern in einer 8-Quadratmeter-Wellblechhütte. Drei schliefen im Bett, zwei auf dem Sofa und einer auf einer Isomatte auf dem Boden. Ab 18 Uhr gabs kein Licht, weil sie keinen Strom bezahlen konnten. Das war wirklich eine krasse Erfahrung zu sehen, wie unterschiedlich das Leben verlaufen kann – obwohl wir im gleichen Alter sind.

Am Mittag hat mich ein Freund gefragt, ob ich mit ihm in den Nairobi Country Club komme. So bin ich am gleichen Tag vom Slum in einen Club gefahren, in dem die Cola acht Euro kostet. Ganz schickes Ambiente mit Tennisplatz, Golfplatz und Sprinkleranlage. Du darfst dort auch nicht fotografieren: Weil es ein Eliteclub ist, musst du dein Handy am Eingang abgeben.
Das war extrem, weil beides am gleichen Tag passiert ist. Aber insgesamt trifft man häufig auf diese Kontraste. Diese Erfahrungen haben mich geprägt. Natürlich gibt es die furchtbare Armut, aber es gibt in sehr vielen Ländern auch den Reichtum und Überfluss. In Nairobi gibt es eine Straße, wo eine Mall neben der anderen steht. Ich denke, davon haben manche Europäer eine falsche Vorstellung. Viele Menschen dort erleben einen ganz normalen Alltag. Du hast die Superreichen, du hast die Armen – und noch eine ganze Menge Leute, die ganz normal wohnen und leben.
Du hast auch in Ghana gewohnt. Wie kam das zustande? Und vor allem: Wie lebt es sich in Ghana?
Wenn man afrikanisch-europäische Beziehungen studiert, geht es häufig um den transatlantischen Sklavenhandel und damit um die Westküste von Afrika – wobei ich mich traditionell im Osten wohler fühle. Für das Auslandssemester bin ich für ein Praktikum für vier Monate in Ghana gelandet.
Es war auf jeden Fall ganz anders. Der Kontinent ist superdivers und vielfältig; das versuche ich in meinem Blog immer wieder zu zeigen. Ghana hat beispielsweise nicht so viel Wildlife. Wenn man ganz in den Norden fährt, kann man mit Glück Elefanten sehen. In Ghana gibt es total schöne Strände, wobei man da kaum baden kann, weil die Strömung so stark ist. Sobald man knietief im Wasser steht, werden einem die Beine weggezogen. Es ist auch eine komplett andere Kultur und Mentalität. Das ist innerhalb der Länder selbst auch schon krass: In Kenia gibt es 43 ethnische Gruppen, in Ghana mehr als 50 lokale Sprachen. Allein innerhalb von Ghana unterscheidet sich die Kultur gebietsweise stark.
Ghana war vom Sklavenhandel ganz anders betroffen als Kenia. Millionen von Menschen wurden entwurzelt. Daher hat man dort einen anderen Blick auf Europäer, als ich es in anderen Teilen Afrikas erlebt habe, und zwar einen durch die Kolonialisierung geprägten.
Ghana hat eine vielfältige Kultur- und Kunstszene, die krass kreativ ist, viele Bars und Tanzclubs. Das kannte ich aus Nairobi so nicht. Natürlich gibt es dort auch Bars und Plätze, die man abends aufsuchen kann. Aber in Accra ist viel mehr los. Die Ghanaerinnen und Ghanaer haben ein stärker ausgeprägtes Selbstbewusstsein, weil Ghana das erste unabhängige Land Afrikas war.
Man kann dort problemlos im Dunkeln durchs Zentrum marschieren, was man in vielen anderen afrikanischen Städten lieber nicht machen sollte. Es ist ein sicheres und stabiles Land, dem es wirtschaftlich auch nicht so schlecht geht wie anderen afrikanischen Ländern.
Kannst du ein bisschen mehr zu den Menschen in Kenia sagen? Wie sind sie?
Mit den meisten, die ich dort kennengelernt habe, komme ich sehr gut klar. Es sind sehr freundliche Leute. Ich wurde dort viel eingeladen. Selbst die Freundin, von der ich vorhin erzählt habe, serviert erstmal Obst, wenn ich da bin. Dann werden die Kinder losgeschickt, um Cola zu kaufen.
Sehr viele sind hilfsbereit. Das gilt für alle vierzehn Länder, die ich in Afrika besucht habe. Ich steige auch gern mal morgens in den Minibus und schaue, wo ich abends ankomme und wo ich eine Unterkunft finde. Unterwegs treffe ich im Bus immer Leute, die mir sagen, wo es super ist. Oder mir den Onkel von ihrem Schwager vermitteln oder einen Kumpel organisieren, der mich für einen guten Preis abholt. Das hat immer prima funktioniert; ich hatte nie das Gefühl, in Gefahr zu sein. Auch in der Gegend, in der ich in Nairobi unterwegs bin, kann ich abends problemlos ausgehen, weil ich da als weiße Person inzwischen bekannt bin. Jeder weiß, wo ich hingehöre. Würde einer mir etwas Böses wollen, kämen gleich zehn andere, die sagen: „Lass sie in Ruhe.“ Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch etwas passieren könnte.
Generell wird man als weiße Frau oft angesprochen; gefühlt jeden zweiten Tag bekomme ich einen Heiratsantrag. Ich fahre auch mit lokalen Transportmitteln, fahre Minibus. Da ist immer einer dabei, der nach meiner Nummer fragt oder mich heiraten will. In den meisten Ländern fand ich das nicht sonderlich aufdringlich. Ich mache dann meist einen Witz, dann lassen sie mich in Ruhe. In Ghana fand ich es extrem nervig. Wenn ich da Nein sagte, kam meist zurück: „Warum nicht? Warum willst du nicht meine Freundin sein?“ Da bin ich auch mal aggressiver geworden, weil sie mir hinterhergelaufen sind, teilweise mit heruntergelassener Hose, das war penetrant und richtig unangenehm. Deshalb fand ich Ghana eher schwierig. Ich will nicht sagen, dass alle Ghanaer so sind; es ist bloß die Erfahrung, die ich dort gemacht habe.
Die ersten Male, die ich in Afrika war, wurde ich kaum angebettelt. In Kenia kenne ich das nicht, dass Leute auf mich zukommen und etwas wollen. In den letzten zwei Jahren hat das zugenommen, vor allem in Gebieten, in denen lange Zeit Dürre herrschte. Die Hürde, nach Hilfe zu fragen, ist gesunken.
Du hast eben gesagt, du steigst in den Bus und weißt nicht, wo du ankommst. Heißt das, du sprichst unterwegs einfach Menschen an?
In den meisten Ländern fährt man in Minibussen mit neun, zwölf oder fünfzehn Sitzen. Da werden so viele Leute hineingequetscht, wie dort reinpassen. In einen Fünfzehnsitzer können das schon 25 Leute sein.
Großartig! (Ich lache.)
Da kommt man zwangsläufig in Kontakt. Weil man drei Stunden auf engstem Raum sitzt. Ich habe Tage, an denen möchte ich für mich sein und ziehe mich zurück, aber meist sind es superlustige Unterhaltungen, die da entstehen. Oft fahren Leute mit, die sich in der Gegend auskennen. Die erzählen mir dann, wohin ich muss.
In Botswana bin ich einmal in den Bus gestiegen und mir war nicht klar, ob ich rechtzeitig ankommen würde, weil die Straße geflutet war. Da ich nicht wusste, ob ich rechtzeitig da sein würde, habe ich mir nichts vorgenommen. Im Bus hatte ich dann mit Leuten gesprochen und von der Unterkunft erzählt, die ich mir schon mal im Netz angeguckt hatte. Daraufhin hat ein Mann direkt seinen Cousin angerufen, der ursprünglich ihn abholen sollte. Die haben mich zusammen dorthingefahren. Sie haben sogar gewartet, um zu schauen, ob wirklich ein Zimmer frei ist. Den Cousin habe ich am nächsten Tag an der Bar gesehen. Er wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist und ob ich mit der Unterkunft zufrieden war.
Natürlich suchen auch viele Kontakt, weil man weiß ist – da darf man sich nichts vormachen. Es gibt welche, die durchaus eine Verbindung zu einer weißen Europäerin wollen. Aber in den meisten Fällen habe ich wirklich hilfsbereite Leute erlebt, die es großartig finden, wenn sich jemand auf das Land und seine Menschen einlässt und nicht einfach mit einem organisierten Touribus durchfährt und Fotos durch die Scheibe macht.
Die Länder haben auch ein Interesse daran, dass die Leute es da gut finden. Sie sind stolz auf ihr Land. Oft hört man: „Ist voll schön hier, nicht wahr?!“ Oder: „Bei uns ist es schöner als in Sambia.“
Das habe ich in Ex-Jugoslawien so erlebt.
Reist du eigentlich immer allein?
Ich bin verheiratet und verreise manchmal mit meinem Mann; wir waren gerade vier Wochen in Madagaskar. Das mache ich supergern. Neulich war ich mit meiner Familie in Portugal. Dazwischen war ich dann aber wiederum zwei Wochen allein in Äthiopien und Kenia.
Ich fahre mindestens einmal im Jahr bewusst allein irgendwohin. Das brauche ich einfach, um mich auf mich selbst zu besinnen. Ich reise ganz anders, wenn ich allein bin, lerne viel mehr Menschen kennen, beschäftige mich mehr mit den Leuten vor Ort, als wenn ich meinen Partner dabeihabe. Dann nämlich gehen wir abends beispielsweise zusammen essen. Wenn ich alleine reise, habe ich die Entscheidung, ob ich allein am Tisch sitzen möchte oder mich vielleicht an der Bar irgendwo dazusetze. Das ist schon eine andere Art zu reisen.
Ich reise auch überwiegend alleine. Bei Afrika würde ich allerdings mehr als zögern. Du meinst also, es sei kein Problem, als Frau allein nach Afrika zu fliegen?
Ich persönlich würde in jedes Land alleine aufbrechen, das ich auch zusammen mit meinem Partner bereisen würde. Alle Länder, die ich als Frau ausschließe, schließe ich auch bei gemeinsamen Reisen aus.
Ich denke, dass viele Menschen, die noch nie auf dem Kontinent waren, ein komplett medial geprägtes Bild haben. Und ich meine hier gar nicht die Nachrichten, sondern alle anderen Medien. Bloß hat das wenig mit der Realität zu tun. In den Ländern, die ich bisher kennengelernt habe, kann man gut als Frau alleine reisen. Ja, man wird angesprochen; damit muss man rechnen. Aber es ist noch nie jemand übergriffig geworden. Wenn man in abgelegenen Gebieten mit traditionellen Communitys unterwegs ist, höre ich manchmal: „Dein Mann lässt dich allein reisen? Komisch. Das würde ich meiner Frau nicht erlauben.“ Das Weltbild kann man blöd finden, aber es ist nichts, was einen persönlich beeinträchtigt.
Ich denke, viele Frauen haben Angst vor einem Überfall oder einer Vergewaltigung. Wenn man mit einem Mann unterwegs ist, hofft man als Frau, dass man sicherer ist, sprich: der Mann im schlimmsten Fall dem Angreifer eine reinhaut.
Das ist ein Irrtum. Wenn dir jemand etwas tun will, wird ihn das nicht stören, dass da ein Mann an deiner Seite ist. Wenn jemand eine Machete rausholt und dein Geld haben will, wird der Mann auch nicht anfangen zu diskutieren.
Weil ich diese Horrorgeschichten auch kannte, hatte ich ganz am Anfang ein wenig Kleingeld griffbereit. Damit ich im Fall des Falles jemandem, der mich überfällt, 10 Euro zuwerfen konnte. Damit habe ich ziemlich schnell wieder aufgehört, weil ich nie in die Situation kam.
Ich kenne ein, zwei Leute, denen tatsächlich etwas passiert ist. Die waren auch nicht nachts in irgendwelchen abgelegenen Ecken unterwegs. Ihnen wurde aber nur das Handy aus der Tasche gezogen.
Grundsätzlich haben die meisten Afrikaner ein Interesse daran, dass man wiederkommt, weil man Geld mitbringt. Deshalb ist der überwiegende Teil gastfreundlich.
Natürlich ist es nicht so, dass Kenia so sicher ist wie Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es Ecken, wo es wahrscheinlicher ist, dass dir etwas passiert. Auch hierzulande kannst du dich nicht zu hundert Prozent schützen.
Mir war es wichtig, da realistisch und nicht mit so vielen Vorurteilen ranzugehen und es in Relation zu setzen. Es ist wahrscheinlicher, dass ich hier im Straßenverkehr sterbe, als dass mir in Kenia etwas passiert. Auch in Kenia ist es wahrscheinlicher, dass mir im Straßenverkehr etwas passiert, als dass ich Opfer eines Verbrechens werde. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das Leben ist einfach gefährlich.
Mir ist bewusst, dass ich nirgendwo komplett sicher bin. Ich meide dunkle Ecken und frage Einheimische oft nach ihrer Einschätzung. So weiß ich schnell, wie hoch das Risiko ist.
Das ist tatsächlich eine interessante Einstellung.
Themenwechsel: Ich habe gesehen, dass du nach dem Abitur in Norwegen gewohnt hast. Wie kam es dazu?
Die Liebe … (Lacht.) Ich hatte einen Norweger kennengelernt, wir haben uns ineinander verliebt. Nach dem Abi wollte ich ins Ausland gehen, eigentlich nach Chile, doch das fand meine Mama nicht so cool. So bin ich nach Norwegen gezogen, um zu sehen, ob das Zukunft hat. Aber wir haben uns, noch bevor ich dorthin gezogen bin, getrennt. Wobei ich insgesamt anderthalb Jahre da war – es war megacool.

So einen Norweger hätte ich auch gern.
Man kann auch ohne Norweger dorthinziehen.
Was ist so cool an Norwegen?
Ich werde oft gefragt, warum Subsahara-Afrika und Skandinavien meine zwei Gebiete sind – weil es auf den ersten Blick komplett konträr wirkt. Das ist aber überhaupt nicht so.
Ich liebe die Natur in Norwegen, die Weite, die Naturverbundenheit der Norweger und Norwegerinnen. Die Leute sind bei jedem Wetter draußen, fahren Ski, Rad, wandern. Man ist draußen, egal welches Wetter sein sollte, packt sich sein Essen ein. Das musste ich auch erst lernen, wusste es nicht von Anfang an zu schätzen, mag es inzwischen aber richtig gern. Und finde diesen Aspekt an Norwegen speziell. Ich habe mich in diesem Lebensstil auch ganz schnell eingefunden. Die Art der Menschen, mit der Natur umzugehen, mag ich sehr gern. Die Leute sind ruhig, wenig gestresst, haben eine relaxte Einstellung zum Leben. Ich habe das als angenehme Work-Life-Balance empfunden.
Norwegisch ist mit die einfachste Sprache, die man als Deutsche mit Englischkenntnissen lernen kann. Daher habe ich sie schnell gelernt; das war ein krasser Türöffner. Wenn ich heute, nach 18 Jahren, immer mal dort bin, freuen sich damalige Bekannte richtig, obwohl wir uns fünf, sechs, acht Jahre nicht gesehen haben. Das finde ich total schön.
Ich mag dieses Zusammensein, dieses In-der-Natur-Sein. Überall gibt es Hütten, in denen du übernachten kannst, ohne fließend Wasser, ohne Internet. Da bist du einfach für ein paar Tage raus, kannst im Schnee spielen, lesen und Tee trinken – oder dich mit Gesellschaftsspielen beschäftigen.
Ich selbst war nur vier oder fünf Tage in Norwegen. In Oslo schien gerade die Sonne, es herrschte eine tolle Stimmung. Kurz nachdem ich aus der Stadt rausgefahren war, kam der erste Berg. Ich hielt an, setzte mich auf eine Bank an dem dazugehörigen See und dachte: „Die Reise hat sich jetzt schon gelohnt.“ Die Landschaft war wirklich spektakulär.

Auf deinem Blog sprichst du vom achtsamen Reisen. Was verstehst du darunter?
Ein bewusstes, nachhaltiges Reisen. Es geht mir dabei nicht darum, nicht zu fliegen, sondern im Einklang mit der Bevölkerung, den Tieren, der Natur und der Kultur vor Ort zu reisen. Das erste Mal, dass ich mir diese Fragen gestellt habe, war bei meiner ersten längeren Afrikareise. Ich habe mich gefragt, wie ich die Menschen dort bezeichnen soll, welche Wörter da angemessen sind – und welche Rassismen in meinem Kopf passieren.
Auf meiner ersten Reise nach Südafrika habe ich einige Sachen gemacht, die ich heute nicht als nachhaltig sehe. Ich wurde von der Polizei angehalten und habe denen Geld gegeben, damit ich weiterfahren durfte. Und es kamen Kinder auf mich zu; denen habe ich ein paar Kekse gegeben, damit sie weggehen. Das würde ich heute auf keinen Fall mehr machen.
Was machst du stattdessen in solchen Situationen?
Nein sagen. Dadurch, dass ich in Kenia in einem sozialen Projekt arbeite, habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung für einige Jahre. Als ich einmal dort war und diese Genehmigung erneuern wollte, meinte der Beamte: „Das dauert jetzt leider ein paar Wochen. Es gäbe natürlich eine Möglichkeit, dass das schneller geht …“ Da sagte ich: „Das passt schon zu warten.“ Er war irritiert. Und natürlich ging es am Ende genauso schnell.
Für mich ist es wichtig, mich mit einem Land zu beschäftigen. Wenn man im eigentlichen Sinne reisen möchte, ist es wichtig, sich mit dem Land und seiner Geschichte auseinanderzusetzen, auch in Bezug auf sein eigenes Herkunftsland. Wer viel in Afrika reist, wird nicht darum herumkommen, sich mit Kolonialgeschichte im weitesten Sinne zu beschäftigen, wenn es mehr sein soll als der All-inclusive-Urlaub in Tansania oder in Kenia.
Es geht auch darum, wie ich auf Menschen zugehe. Da ich häufig über Afrika blogge, kommen immer wieder Menschen auf mich zu, die unsicher sind, wie sie sich bei ihrer ersten Reise verhalten sollen. Ganz viele denken, sie sollten einen zusätzlichen Koffer mit Spenden mitnehmen, um damit Gutes zu tun.
Ich habe mich mit den Dingen beschäftigt, habe in dem Bereich meinen Master gemacht, bin seit 2013 sehr oft in Subsahara-Afrika unterwegs und habe deshalb schon ein wenig Ahnung – auch wenn ich keine Expertin bin. Ich denke, ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt als die meisten Menschen. Den Leuten sage ich: „Das ist total nett gemeint, aber es hat auch Folgen.“
Wenn ich einem Kind Süßigkeiten gebe, weil es so nett lächelt, ist es für den Moment vielleicht die richtige Entscheidung. Aber ich beschäftige mich nicht damit, welche Folgen es nach sich zieht. Wichtig ist ja, wie es für dieses Kind weitergehen kann. Mir ist es wichtig, nicht nur an den einen Moment zu denken, sondern generell einen Denkanstoß zu geben. Für uns ist es dieser eine Urlaubsmoment, aber für die Menschen vor Ort hat es Konsequenzen.
Welche denn?
Wenn ich einem Kind Süßigkeiten gebe, sende ich das Signal: „Du Empfänger, ich Geber.“ Ich präge also das kolonialistische Bild: süßes schwarzes Kind, wohltätige weiße Frau. Dabei kenne ich die Umstände, in denen das Kind lebt, gar nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Zahnbürste hat oder einen Zugang zur Medizin. Ich weiß nicht, wie es sich ernährt. Süßigkeiten bei einer ansonsten ausgewogenen Ernährung sind in Maßen kein Problem. Ich weiß allerdings nicht, wie oft dieses Kind von anderen Touristen Naschkram bekommt. Möglicherweise ernährt es sich hauptsächlich von Süßigkeiten. Diabetes ist die am weitesten verbreitete Krankheit in Kenia.
Irgendwann geht es nicht mehr um Bonbons, sondern um Spielsachen, Stifte, Bücher. Damit festigt sich möglicherweise das Schema, dass das Kind nur süß zu gucken braucht, damit die weißen Leute etwas geben. Es kommt häufig zu Situationen, wo Eltern ihre Kinder nicht in die Schule schicken, sondern stattdessen zum Betteln. Auf diese Weise kriegen sie hier und da mal etwas zugesteckt und die Eltern verkaufen das vielleicht weiter. Das funktioniert mit Kindern besser als mit Erwachsenen. In Nigeria, Ghana, Gambia, Senegal, Tansania und Kenia sieht man immer wieder, dass so etwas in Prostitution endet: Wenn die Kinder älter werden und nicht mehr süß genug sind, müssen sie anfangen, Dinge zu verkaufen. Und wenn das nicht funktioniert, verkaufen sie ihren Körper.
Das passiert natürlich nicht mit jedem Kind, dem man etwas gegeben hat. Aber so etwas kann die Gesellschaft verändern.
Die erste Regel, die ich gelernt habe, war: Mach unterwegs nichts, was du nicht auch in Deutschland machen würdest. Du würdest einem Kind hier in Deutschland auch keine Süßigkeiten zustecken, weil vermutlich ein paar Stunden später entweder die Eltern vor deiner Tür stünden oder die Polizei.
Das sind Armutsspiralen, die da kreiert werden – aus einer guten Intention heraus. Niemand, der was gibt, möchte ja etwas Böses.
Was ist eigentlich deine Sichtweise auf die Negerkussdebatte, die in Deutschland nach wie vor aktuell ist?
Vom Beruf bin ich Journalistin. Das heißt, ich bin sensibilisiert dafür, was Sprache bewirken kann. Sie ist ein machtvoller Hebel. Ich verstehe nicht, warum es Menschen so wichtig ist, dass sie das N-Wort noch sagen können. Wieso geilen sie sich so daran auf, dieses Wort zu nutzen, wenn sie wissen, dass sie damit viele andere Menschen verletzen?
Wenn zu mir jemand sagt: „Hey, das Wort ist rassistisch “, dann überdenke ich das und streiche den Begriff aus meinem Wortschatz. Es ist egal, wie die Aussage gemeint ist, Rassismus hat nichts mit der Intention zu tun, sondern steckt im Wort selbst. Ich will andere Menschen durch meine Sprache nicht verletzen. Sie sollen sich willkommen, inkludiert und als Mensch fühlen.
Ich kann nicht verstehen, warum es so schwierig ist, auf zehn Wörter zu verzichten, die nachgewiesenermaßen problematisch sind. Und zu denen es gute Alternativen gibt. Muss ich „Indianer“ sagen, wenn ich „Indigene“ sagen kann? Manche denken, sie hätten ein Recht darauf, andere zu verletzen.
Noch einmal zurück zum Thema „Als Frau alleine reisen“: Frauen haben Befürchtungen, allein zu reisen, allein im Café zu sitzen. Sie haben Angst davor, mit sich nichts anzufangen zu wissen. Was würdest du diesen Frauen als Rat mitgeben? Jenen, die noch zögern.
Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass das Alleinreisen nicht für jeden etwas ist, unabhängig davon, ob Mann oder Frau. Nicht jedem wird es gefallen. Eine der größten Errungenschaften in meinem Leben war die, dass ich relativ früh herausgefunden habe, wie ich meine Freizeit verbringen will. Manchmal möchte ich allein reisen, manchmal mit meinem Partner.
Das Alleinreisen wurde in den letzten Jahren gerade bei Frauen gehypt; aber es ist nichts, was man zwingend absolviert haben muss. Ich mache es supergern und freue mich über jede Frau, die daran Gefallen findet, aber ich freue mich auch über jede Frau, die herausfindet, dass sie es nicht mag. Ich würde nicht pauschal dazu raten.
Ich spreche aus einer privilegierten Lage, weil ich schon sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen wurde. Mit 13 Jahren bin ich allein mit dem Zug quer durch Deutschland gefahren: von Heidelberg, wo ich großgeworden bin, zu einem Jugendlager in Schwerin. Ich kam in diesem Camp an, ganz allein mit 400 Leuten, die ich nicht kannte. Das war für mich normal.
Beruflich bin ich es von meinen Dienstreisen gewohnt, hin und wieder allein zu essen. Damit hatte ich zum Glück kein Problem, aber auch nicht damit, mit mir allein zu sein. Ich glaube, es geht darum, sich darauf einzulassen. Hinzuspüren: Was brauche ich gerade? Ist das eine Angst, die mich vor einer gefährlichen Situation schützt, oder ist es eine Angst, die ich überwinden kann, um mir ein Stück Freiheit zu erobern? Eine gewisse Angst ist normal.
Ich bin auch aufgeregt, wenn ich in den Flieger steige. Aber es gibt auch Menschen, die lassen sich von ihrer Angst ausbremsen. Hin und wieder hat Angst ja eine Funktion. Wenn ich Angst habe, dass ich in eine Situation komme, mit der ich nicht umgehen kann, dann sollte ich es sein lassen. Wenn es aber nur die Angst ist, dass mich jemand blöd angucken könnte, weil ich allein im Restaurant sitze, dann ist das keine hilfreiche Angst. Vielleicht lohnt es sich in diesem Fall, sich zu überwinden und es mal auszuprobieren.
Was kann denn passieren? Ich gehe allein ins Restaurant und werde dumm angeguckt. In aller Regel passiert das im Kopf und nicht in der Realität. Aber selbst wenn, kann man ja auch einfach gehen. Im schlimmsten Fall habe ich eine Stunde meines Lebens verloren, bin aber um eine Erfahrung reicher.
Ich mag den Begriff des Scheiterns nicht. Für mich gibt es das einfach nicht. Es ist eine große Errungenschaft, wenn ich feststelle, dass ich etwas nicht möchte und lieber gehen würde. Gerade Frauen, aber auch Männer, sollten nicht darauf schauen, was von ihnen erwartet wird, sondern was sie gerade möchten. Anderenfalls wäre ich auch nie aus meinem Nest herausgekommen.
Wir treffen jeden Tag Entscheidung und können auch die Entscheidung treffen, diesen Schritt zu gehen. Und im Zweifel gehen wir wieder einen Schritt zurück. Wenn ich allein in den Urlaub fahre und es gefällt mir dort nicht, fahre ich einfach wieder nach Hause.
Vielen Dank für die zahlreichen neuen Perspektiven, Miriam! Und noch weiterhin viele tolle Eindrücke und Einsichten auf deinen Reisen.
Möchtest du mehr zu Miriams Reisen erfahren? Hier geht es zu ihren Blog „Nordkap nach Südkap“.
Wenn du dich von den Reisen anderer toller Frauen inspirieren lassen möchtest, schau in die Facebook-Gruppe „Als Frau alleine reisen? Na klar!!!!“.
Und wie reisen Männer? Hier geht es zu den Interviews rund um außergewöhnliche Männerreisen: „Verbrüderung mit dem vermeintlichen Feind. Oder: Urlaub in Nordkorea“, „Es fliegt eben nicht an jeder Ecke was in die Luft – Freizeitreisen in Krisengebiete“ und „Moldawien macht Spaß“.
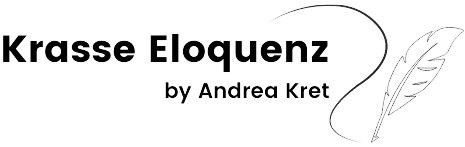


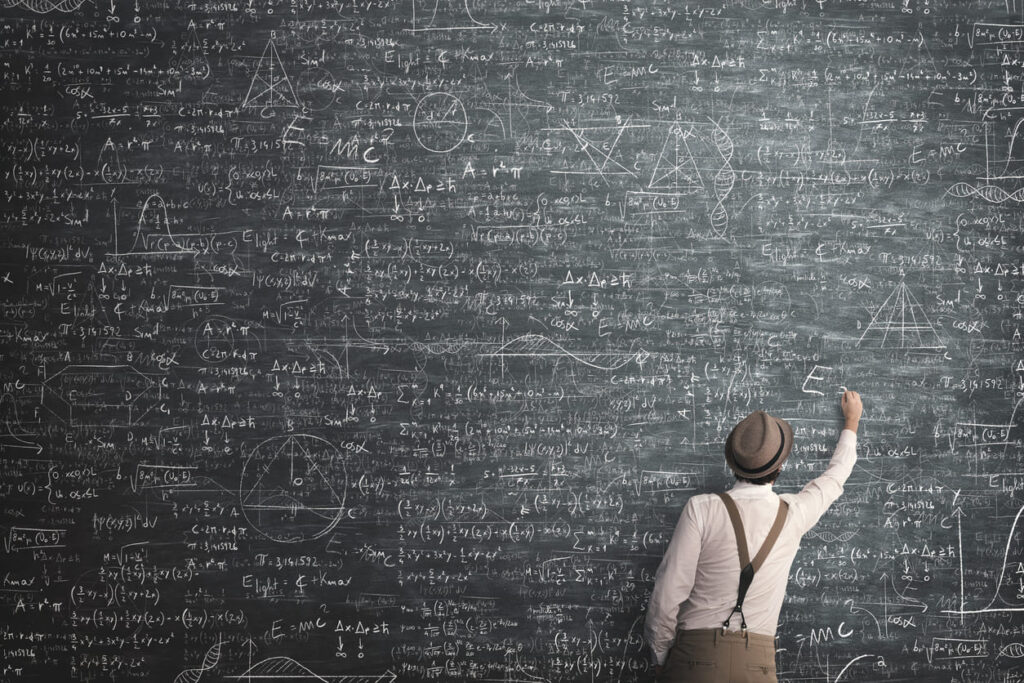
Pingback: „Moldawien macht Spaß“ – Krasse Eloquenz