Du möchtest diese Satire lieber hören? Eingesprochen von der Uddelhexe, einer großartigen Sprecherin? Hier geht’s lang.
Die Anzeichen waren früh da: Bereits vor der Einschulung verprügelte ich meinen drei Jahre älteren Cousin Raffi, zwei Köpfe größer und um einiges stämmiger als ich, weil er mit mir nicht ins Kino gehen wollte. Der hatte schon keinen Bock, bevor es die Null-Bock-Generation überhaupt gab. Und musste dafür büßen.
Nachdem getan war, was getan werden musste, ging ich alleine los und zog mir so tolle Streifen rein wie die „Mumins“ oder „Winnetou“. Einmal mit meiner Cousine Kamila, die den gesamten Film über – diesmal „Indiana Jones“ – mit dem Rücken zur Leinwand stand und fasziniert die anderen Kinobesucher studierte. Sie habe ich nicht verdroschen, das tut man nicht, sondern trat stattdessen mit Mutter, Onkel, Kumpel der Mutter und diversen Schulkameraden aus der ersten Klasse dem neu eröffneten Karateverein bei.
Ich erwartete Szenarien, wie man sie aus Karate Kid kennt. „Angst herrscht nicht in diesem Dojo“ – mit Nachdruck und Überzeugung vom Trainer vorgetragen, der sich als der Bösewicht entpuppte und natürlich viel exzellenteres Karate draufhatte als die von der guten Seite. Unser Trainer, im wahren Leben Bediensteter des örtlichen Finanzamtes, sagte Sachen wie: „Was machst du da mit deiner Hand, Heiner? Du sollst sie nicht halten wie einen sterbenden Schwan.“
Eigentlich war Karate Kid ein schöner Film gewesen – mit einem Manko: Der Hauptdarsteller hatte keinen blassen Schimmer von Kampfkunst. Ich wartete vergebens, bis wir in unserem Dojo die Übung „Kranich“ ausführen würden, musste stattdessen Bahnen auf und ab gehen mit immer gleichen Arm- und Beintechniken – und als Highlight nach sieben Jahren: die „Bärentatze“ – wenigstens etwas. Ein Sport für Memmen, sagen heute einige auf YouTube, Vollkontaktboxen sei viel besser. Ja, das stimmt. Für die, die überlebten.
Immerhin musste ich an Weihnachten keine Blockflöte spielen, sondern wurde von den Eltern aufgefordert: „Mach eine Kata, Andrea. Zeig der Oma eine Kata.“
Ich sträubte mich; die Oma schaute fragend, denn ihr war offenbar nicht klar, dass Kata eine Form war, eine Art stilisiertes Kämpfen. Ich ließ mich bitten und gab erst nach, als für mich ein Zehner herausspringen sollte. Die Oma staunte Bauklötze, sagte etwas von Bruce Lee! – wo sie das nun wieder her hatte, der machte doch Kung-Fu – und alle waren glücklich und zufrieden. Sogar Kanku, „der in den Himmel Schauende“, wie mein Hund hieß, der der Inszenierung ebenfalls beigewohnt hatte und sich mittlerweile wieder den Hintern leckte. (Kanku war übrigens ebenfalls der Name einer Kata.) Nur einmal, beim Kiai, dem Schrei nach einer besonders explosiven Technik, sprang er auf und wollte die Oma verteidigen. Diese, ganz erschrocken, fiel rückwärts in den Sessel.
Im Teenageralter nannte man mich Holzhammer. Vielleicht wegen meiner gefürchteten Abwehrtechniken. Cousins und andere Jungs aus dem Sportverein verkloppte ich nicht mehr, wehrte ihre Angriffe aber so geschickt ab, dass sie hinterher in der Schule kaum den Füller in der Hand halten konnten und lieber fortan auf ernstzunehmende Angriffe verzichteten.
Mit sechzehn hatte ich alles durch, den dritten braunen Gürtel in der Tasche, einen vor dem schwarzen, und war voller Ambitionen. Ich meldete mich zum Wettkampf an: Frauen, 40 bis 45 Kilo. Dabei hatte ich großes Glück, dass ich mir beim Training noch rechtzeitig den kleinen Zeh brechen konnte. Am Tag des Wettkampfs sah ich nur, wie die Weibsbilder aufeinander eindroschen, und humpelte schnell davon.
Mit 18 wollte ich es wissen, fragte den Trainer, ob ich meine Schwarzgurtprüfung ablegen könne, doch der schaute nur erstaunt, was für mich Antwort genug war und meine Karatekarriere vorzeitig beendete. Passte gerade ganz gut, denn inzwischen waren die Trainingskameraden breiter geworden und ließen sich nicht mehr so leicht vermöbeln und außerdem lagen Partys bis zum Umfallen zu der Zeit eher in meinem Fokus.
Jahre später, nachdem ich mich durch und durch ausgetanzt und jede Party mitgenommen hatte, kam die Zeit, wieder etwas Ernsthaftes zu tun. Ich ging einer richtigen Arbeit nach – ein echter Sport musste her. Ich trat in einen Sportclub ein und begann mit „Super Sweat“. Dort schwitzte ich wirklich super – einziger Nachteil: Ich holte mir wegen Übermotivation eine Zerrung an der Achillessehne, konnte die nächsten zwei Wochen nur in Schuhen mit hohen Absätzen gehen – aus dieser Zeit stammen meine Hausschuhe mit dezentem Absatz – und das Treppabgehen schaffte ich nur Stufe für Stufe, einen Fuß stets nachziehend.
Bei Step Aerobic, das ich nicht minder exzessiv betrieb, zog es an einer anderen Stelle, im Oberschenkel. Jetzt konnte ich die Treppen zwar wieder ordentlich hinuntergehen, nicht aber hinauf.
Ich versuchte es mit Aqua Jogging zu Justin Timberlake, das war muskel- und gelenkschonend. Und zwar in einem hippen Club, in dem man sich vor dem Training schminkte und zusah, sich nicht zu sehr anzustrengen, um hinterher nicht wie Alice Cooper auszusehen – das war hier aus ästhetischen Gründen nicht gern gesehen und wurde von den anderen Sportelnden mit Nichtbeachtung geahndet.
Nach einem Jahr wechselte ich spaßeshalber den Club. Hier tauchte das entstellende Wort „Schweiß“ in keinem Kursnamen auf, stattdessen versuchte man, mithilfe vibrierender dünner Stangen die unteren Muskelschichten zu erreichen. Hier waren die Mercedes-Fahrer unter sich, und als bei Aqua Gym der Refrain „Ah, ah, ah, ah, stayin’ alive, stayin’ alive“ erklang, war alles klar.
Ich wechselte wieder und beschloss im nächsten Club, dass das Sich-an-der-Stange-Räkeln und der Ausziehkurs – bei dem man sich ja gar nicht auszog, sondern nur so tat, als ob – nicht die passenden Sportarten für mich waren.
Auf Nordic Walking würde ich so in dreißig, vierzig Jahren zurückkommen. Meine letzte Hoffnung waren Nia, bei dessen Ausübung man sich vorstellen sollte, man sei die tanzende Freiheitsstatue – oder ein Rennauto – oder ein Clown, der über eine Schwertkampfausbildung verfügt, und Capoeira!
Capoeira war wie Karate! Bloß aus der Hocke heraus. Nach dem zehnten Tritt nach oben wäre mein Bein nur noch per Lastkran zu heben gewesen. Ich blieb gleich liegen und kam erst hoch, als wir zur Partnerübung aufgerufen wurden: Ein brasilianisches Mädel tänzelte um mich herum, deutete Schläge an, duckte sich, drehte ein Rad, kickte flink durch die Luft. Ich war etwas unsicher; mir war nicht klar, was man von mir erwartete. Mit einem gezielten Fauststoß streckte ich sie nieder und mein Vertragsverhältnis mit dem Club war ohne lange Wartezeit gekündigt.
Ich fing wieder mit Karate an.
Interessiert dich das Thema Karate? Ich habe Sensei Thomas Volkmann (6. Dan) dazu interviewt: „Beim Karate gibt es keine Regeln“
Eine Selbstverteidigungssatire gibt es hier: Wurfmesser und andere Nützlichkeiten
Das Titelbild zeigt die Autorin im zarten Alter von 16 Jahren.
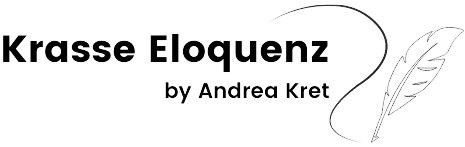



Pingback: „Beim Karate gibt es keine Regeln“ – Krasse Eloquenz
Pingback: Wurfmesser und andere Nützlichkeiten | Satire