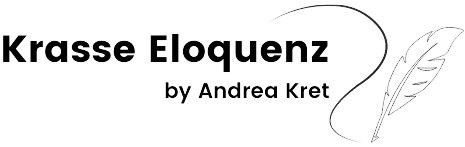Heutzutage ist das mit den Bewerbungen nicht so einfach. Ein dahingeworfenes „Hiermit bewerbe ich mich für die Stelle des/der Inbound Project Management Developer/-in bei Ihnen“ reißt keinen mehr vom Hocker. Auch von Anfängen wie „Ich habe Ihre Stellenanzeige in der Zeitung gelesen und interessiere mich für die Stelle“ wird eher abgeraten. Das Bewerben ist ein mühevoller Prozess der Selbsterkenntnis, des Meditierens über das Unternehmen, mit dem man sich zu vereinigen gedenkt; da gibt es Assessment-Center, wo der eigene Kurs innerhalb von Sekunden fallen kann, Stressinterviews, in denen Kindheitstraumata zum Vorschein kommen – und zum Schluss können sie einem alle den Buckel runterrutschen, weil man den Job eh nicht bekommen hat.
Telefoninterviews: ebenfalls ein neuer Trend – zumindest wenn man noch im Jahr 2010 steckt. Der moderne Personaler möchte sich im Vorfeld ein Bild machen – zum Glück nicht per Bildtelefon. Ich hing nämlich gerade in meiner Einzimmerwohnung am Apparat und quatschte mit dem HR-Leiter, der wirklich harmlos und zivil schien – ich hatte mich um eine Stelle als Korrektorin beworben. Hing förmlich am Apparat, denn das Kabel hatte sich verheddert, reichte nicht bis an mein Ohr, sodass ich eine unnatürlich gebückte Haltung einnehmen musste. Dabei hatte ich gelesen, dass man ein solches Gespräch partout im Stehen führen sollte, um das volle Volumen der Lunge auszuschöpfen. Vorsichtig entwirrte ich das Kabel mit einer Hand, dabei auf meine blank geputzten Schuhe und den Ansatz des Nadelstreifenanzugs mit Bundfalte schauend und zusehend, dass ich den Faden nicht verlor. Ich stand auf meinem durchgetretenen Teppich, der an den Rändern schon ausfranste, und hatte mich strategisch so hingestellt, dass ich das aufgeklappte Bett direkt in meinem Rücken nicht sehen musste – das hätte zu viel negatives Feng-Shui gegeben. Den Zeitpunkt des Telefonats hatten wir zwei Tage vorab vereinbart, aber man kennt das ja: Zeit wird unterschiedlich wahrgenommen und an diesem Morgen lief sie einfach zu schnell. Die Eierschalen und Brotkrumen auf dem Tisch hatten ihren Weg noch nicht in den Abfalleimer gefunden, als der wichtige Anruf kam, dafür klemmte immerhin eine Aktentasche unter meinem linken Arm und verlieh mir ein Gefühl von Professionalität.
Auf alles war ich vorbereitet bei diesem Interview, alles. Ich hatte erfahren, dass Ungeduld bei der Frage nach Schwächen im Arbeitsleben nicht mehr herhalten konnte, hatte mir andere passable Schwächen zurechtgelegt, wusste, wie ich jeden glitschigen Stein auf diesem Bewerbungsweg geschickt umging, doch auf die Frage, die jetzt kommen sollte, kannte ich keine Antwort.
„Wohnen Sie in einem Hotel?“
Es sind Bruchteile von Sekunden, in denen man den tieferen Sinn einer solchen Frage zu ergründen versucht, die einem vorkommen wie lange Minuten. Okay, Hotel also. Sehr ungewöhnliche Herangehensweise. Wollte er damit eruieren, ob ich einen festen Wohnsitz hatte? Dachte er, ich hätte womöglich überhöhte Gehaltsvorstellungen – wie jemand, der in einem Hotel residiert? Udo Lindenberg zum Beispiel. Oder hatte er sich vorgenommen, eine derart absurde Frage zu stellen, dass ich mir so gar keinen Reim darauf machen konnte, um dann meine Reaktion abzuwarten? „Wollen Sie mich verarschen?“ wäre ja eine mögliche Replik gewesen. Mit der sich die Personalleitung gleich ein langes Palaver vor Ort erspart hätte. Zack, abgehakt. Ich aber antwortete etwas anderes, ich kam ihm mit der Essenz meiner über Sekunden angestellten Überlegungen zu dem Thema.
„Hä???“
Ein einfaches Hä, nicht aggressionsgeladen, nicht renitent, na gut, ich mischte einen Hauch von urbaner Professionalität hinein. Ansonsten ließ ich mein Hä möglichst neutral klingen.
„Na, ob Sie im ‚Excellence‘ wohnen.“
Ich hatte keinen blassen Schimmer, welche Nuancen ich in ein weiteres Hä hätte hineinlegen können, daher stotterte ich lediglich mein Nein. Damit war das Gespräch beendet. Ich warf die Frühstücksreste in den Müll und die nassgeschwitzten Klamotten in den Wäschekorb.
Unerwarteterweise hatte ich den Stresstest bestanden, da man mich erneut vorlud; mein zukünftiger Abteilungsleiter sollte bei dem Termin ebenfalls vor Ort sein. Ralph war etwa zwei Meter groß, reichte mir seine riesige Pranke und begrüßte mich mit den Worten: „Kennen wir uns nicht irgendwo her?“
Was für eine Firma! An jeder Ecke lauert ein Fettnäpfchen. War das eine weitere Kammer der Shaolin, die ich durchschreiten musste, in der ich geprüft wurde, um den Job am Ende zu kriegen? Wie die Shaolin-Mönche, die in jeder Kammer körperlich und mental auf die Probe gestellt wurden, bevor sie von sich behaupten konnten zu wissen, wo Barthel den Most holt. Bloß: Auf welches Niveau begaben wir uns hier? Unterstes Baggerniveau, das man nur aus Erzählungen kennt. Es fehlte nur, dass Ralph „Kommst du öfter hierher?“ sagte. Oder war das einer der Typen aus dem Internet, die ich mal gedatet hatte, ohne hinterher ihre SMS mit dem Wunsch nach einem Wiedersehen zu beantworten? Ich weiß selbst nicht, was für ein Gesicht ich bei dieser Einstiegsfrage im Türrahmen machte. Offenbar kein allzu dummes, denn ich wurde in die nächste Kammer der Shaolin gebeten. Nach Gesprächsende sollte ich, ganz spontan, eine Runde vor Ort korrigieren, doch vorher wollte man mich herumführen. Ich sagte Ja und dachte: „Auweia.“ Mich plagten leichte Kopfschmerzen wegen zu wenig Schlaf. Auch hatte ich auf mein Frühstück verzichtet – das wollte ich nach vollbrachter Tat zu mir nehmen – eine Stunde ohne Nahrung würde ich schon durchhalten. So der Plan. Zu trinken hatte ich natürlich ebenfalls nichts mit, aber man liest ja überall, man würde erst nach zwei Tagen verdursten.
Ich wurde also rumgeführt. Meinen zukünftigen Kollegen Konrad lernte ich auf dem Weg zur Gemeinschaftsküche kennen und sollte später feststellen, dass er genau dort am häufigsten anzutreffen war. Man rätselte, wie er sein Arbeitspensum schaffte und ob er sich abends in der Firma auf Klo versteckte, eingeschlossen wurde und auf diese Weise sein Tageswerk vervollständigen konnte, weil er so gut wie nie an seinem eigentlichen Platz saß und arbeitete. Ralph zeigte mir die Küche, danach die Abstellkammer. Führte mich in den zweiten Stock mit bodentiefen Fenstern, wo ein weiterer – lichtaffiner – Kollege mit drei aufgeschlagenen Duden-Bänden saß. Ein echter Korrektor. Die anderen beiden, Ralph und Konrad, waren wie Kellerasseln bei spärlichem Licht in der untersten Etage untergebracht. Ralph setze mich an den eigens für mich hergerichteten Tisch, drückte mir einige Blätter und Stifte in die Hand: Hier – machen. Der Stuhl war zu hoch eingestellt, ich zerrte einige Male vergeblich am Hebel, wollte jedoch in der Korrektoratsstille keinen Radau machen. Zumal sich auch Konrad aus der Küche wieder eingefunden hatte. Ich blieb so sitzen, meine Beine baumelten in der Luft, mein Oberkörper war nach unten gebückt, ich hatte Hunger und lektorierte Verputzmittel.
„Bekomme ich keinen Duden?“, wollte ich von Ralph wissen. Der schüttelte den Kopf. Ein Freestylelektorat also. Ohne den Duden war ich ein Nichts.
Ich improvisierte die nächsten zwei Stunden, fantasierte über Schnitzel mit Pommes, fand kaum Rechtschreibfehler, las erneut und gab den Wisch ab. Ich wollte raus. Es galt, eine letzte Hürde zu absolvieren, die letzte Shaolin-Kammer, teilte mir Ralph mit: ein klitzekleines Abschluss- und Evaluationsgespräch bei der HR-Leitung.
Als ich wieder draußen stand, pinkelte ich mir fast in die Hose, weil Ralph mir beim Rundgang zwar die Abstellkammer, nicht aber die Toilette gezeigt hatte. Essen war mir inzwischen egal.
Gut, dass ich mir „Die 36 Kammern der Shaolin“ früher so oft angesehen hatte. Ich war auf das Leben vorbereitet. Und bekam den Job.
Nur noch einmal wurde es komisch, ein Jahr später, als ich mit Fieber im Bett lag und Ralle, Ralph, telefonisch darüber informierte, dass ich die komplette Woche ausfallen würde. Da wurde er seltsam und fragte mich, ob ich im Spa-Bereich des Hotels „Excellence“ chillen würde, um wieder zu Kräften zu kommen.
Diesmal war es einfacher: „Ja, ich habe hier eine Suite wie Udo Lindenberg“, erwiderte ich und dachte: Hört das denn nie auf?
Die Gereiztheit in meiner Stimme kam wohl am anderen Ende an, und so erklärte Ralle mir, bei meiner Nummer würde in dem Telefonsystem unseres Unternehmens angezeigt, dass ich aus dem besagten Hotel anriefe. Eine Fehlprogrammierung. Nein, nicht ganz. Ich schleppte mich ermattet zum Rechner und begann meine Recherche mit einem erstaunlichen Ergebnis: Das Hotel hatte eine vierstellige Telefonnummer und diese vier Zahlen waren identisch mit den ersten vier Zahlen meiner eigenen Nummer, nur dass meine insgesamt achtstellig war. Jeder, der nach der vierten Ziffer zögerte, nachdenken musste, durch Mutti, die zur gemeinsamen Verspeisung von Miracoli aufrief, abgelenkt wurde, kam automatisch beim „Excellence“ heraus, anstatt bei mir.
Ralle kannte ich übrigens aus einem Rhetorikkurs. Er hatte monatelang hinter mir gesessen und war mir trotz seiner zwei Meter nie aufgefallen.
Titelfoto: © iStock/Boris Jovanovic