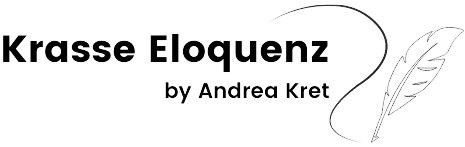Ins „Paolo’s“ wollen wir. Hört sich nett an und ich will bei dem allseits beliebten Deppenapostroph (die Gastonomen lieben ihn), an dem nun wirklich nichts Deutsches dran ist – geschweige denn was Italienisches – ein Auge zudrücken. Brechend voll, gute Stimmung, atmosphärischer Gewölbekeller. Und damit keine Zweifel aufkommen, werden die Damen vom Besitzer mit „Boni sierra, signora“ begrüßt. Ich bin hier mit meinen Kollegen von „Tradolingua“, dem Premium-Sprachdienstleister. Lea aus dem Team, das für die europäischen Sprachen zuständig ist, bestellt zuerst. Spinaci al Forno und eine Insalata mista.
„Nummer!“, sagt der Kellner und wiederholt, als er Leas verblüfften Blick sieht: „Nummer.“
Okay, die Nummern 2 und 5 sollen es sein. Ich nehme die 12, Spaghetti con Scampi piccante.
„Wäre es möglich, die in Nichtscharf zu bekommen?“ Der Kellner versteht nicht. Ich sage „scharf“ und mache eine resolute Bewegung mit der Hand, begleitet von einem Kopfschütteln.
„12 ohne Scharf, ja.“ Die Bedienung nickt. Wunderbar, denke ich und bin mir fast sicher, dass die Spaghetti dennoch „piccante“ sein werden. Moritz nimmt gegrillten Tintenfisch und möchte wissen, welche Beilage es dazu gibt. Er schaut in das verständnislose Gesicht des Kellners. „Beilage“, wiederholt er. Als ob der es dadurch besser verstünde … Die anderen zeigen sich hilfsbereit, deuten neben sich auf den Tisch: „Beilage.“ Der Kellner macht Kulleraugen, hat das Wort nicht in seinem Repertoire. „Che cosa …“, setzt Moritz an, versucht es mit seinem Urlaubsitalienisch, doch die Miene des Kellners lässt erahnen, dass er sich nicht abzumühen braucht. Kathrin probiert es mit Spanisch. Immerhin hat sie es viereinhalb Jahre lang studiert; nun könnte es sich auszahlen.
Fehlanzeige. Chris wählt die portugiesische Herangehensweise, bloß ist die genauso wenig zielführend wie sein direkt im Land erprobtes Japanisch. Ich tippe auf Kroatisch. Njet – Russisch ist es auch nicht. In seiner Verzweiflung versucht es Moritz mit der Sprache seines Vaters, Maltesisch. Da muss er sich schon sehr anstrengen, denn er ist hier geboren. Der positive Effekt bleibt auch diesmal aus.
„Welche Sprache sprechen Sie?“, will ich sachlich wissen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. „Welche Sprache?“, wiederhole ich mit Nachdruck.
„Polnisch.“
Volltreffer!
„Może pan nam powiedzieć, jaki tam jest…“, sprudelt es aus mir heraus, doch dann stocke ich, denn mir fällt trotz Muttersprachlichkeit das Wort für „Beilage“ auf Polnisch nicht ein. Verdammt. Ich versuche zu umschreiben: „No wie pan, taki tam…“, mühe mich ab, unterbreche jedoch wieder, weil die Verwirrung des Kellners zunimmt, sein Blick unsicher von einem zum anderem wandert und er schließlich „To-mate“ artikuliert.
„Tomate ist gar nicht Polnisch!“ Ich schaue erstaunt in die Runde, die erstaunte Runde schaut zum Kellner. Der wiederum weiß nicht, wohin mit seinem Blick und stammelt etwas von „patate“, was wir durchgehen lassen, damit der Rest auch noch bestellen kann.
Wir machen uns Gedanken: Keine Sprache aus unserem breiten Portfolio hat gezogen. Der Mann konnte einfach keine europäische Sprache, und arabisch oder asiatisch sah er jetzt nicht aus. Auch keine erkennbaren afrikanischen Einflüsse. Ein Mann, der keine Sprache dieser Welt spricht, ein wahrlich interessantes Phänomen. – Über das wir länger nachdenken können, weil die Gerichte auch nach einer Dreiviertelstunde nicht eintreffen. Leas drei Freundinnen, die deutlich nach uns eingetroffen sind, mampfen bereits, unter anderem „den schlechtesten Lachs der Welt“, wie Freundin Nummer eins bemerkt.
„Alles okay?“, erkundigt sich Kullerauge. Das können wir nur bejahen, denn den schlechtesten Lachs der Welt haben wir noch nicht gekostet. Kullerauge zieht ab. Moritz, der direkt vom Basketballtraining gekommen ist, verputzt die Reste des trockenen Brots mit der Mayosauce im Schälchen, wird unruhig. Er fängt den sprachenlosen Kellner, der wiederholt an unserem Tisch vorbeischleicht, ab und fragt ganz simpel: „Wann bekommen wir unser Essen?“
„Essen?!“ Die Kulleraugen werden groß, als hätte der Kellner Unerhörtes vernommen.
„Ja, Essen. Essen wollen wir.“
„Drei Minut …“
Alles klar, damit kann man leben. Wir entlassen Kullerauge und fantasieren über Tiefkühlcalamares, die in der Mikrowelle warm gemacht werden. Die Visualisierungstechnik bringt nicht den gewünschten Erfolg. Keine Calamares finden den Weg auf unseren Tisch. Wir rufen den Boni-sierra-Typen vom Anfang, den Besitzer, den Big Boss. Der überblickt die Lage schnell, zückt seinen Block und wird pragmatisch: „Okay, was wollt ihr?“
Dies ist die Gelegenheit. Alle beten ihre Anfangsbestellung wieder herunter, ich schwenke um auf die Tiefkühlcalamares statt der „piccanten“ Scampi. Und bin in der nächsten halben Stunde froh, dass ich keinen so großen Hunger habe, denn die Speisen lassen weiterhin auf sich warten. Mit den Freundinnen von Lea ist Big Boss schon bei „Schatzi“ angelangt, doch das tröstet uns nicht. Moritz hat Kohldampf.
Chris und ich, wir überlegen, uns auf den Dönerladen nebenan einzulassen, wenn unser Essen nicht binnen fünfzehn Minuten kommt. Moritz aber will nicht – er hat sich so auf die Mikrowellencalamares gefreut.
Diesmal haben wir Glück. Zwanzig Minuten später wird unsere Bestellung serviert.
Ich höre, wie die „Spaghetti ohne Scharf“ angekündigt werden, greife zögerlich nach dem Teller. Moritz bekommt seine heißgeliebten Calamares. Und weil die so beliebt sind, gibt es sie gleich zweimal. Ich kriege ein schlechtes Gewissen – wegen meiner Doppelbestellung. Die Kollegen ermuntern mich: „Nix da, nicht unsere Schuld. Wähl doch aus, was dir besser schmeckt.“ Das angeblich entschärfte Gericht ist mir dann doch zu heikel – ich halte zu Moritz und seinen Calamares. Das doppelt Bestellte lassen wir knallhart zurückgehen. Moritz will was sagen, aber der Kellner ist schon weg.
Chris weigert sich, seine Bestellung anzunehmen, denn die sieht genauso tomatig aus wie das Schweinefilet mit Tomaten seiner Nachbarin. Er hingegen hatte Seezunge bestellt, stellt den Teller beiseite, ruft den Besitzer, deutet auf seinen Teller. Big Boss schiebt diesen freundlich, aber bestimmt an seinen ursprünglichen Platz.
„Was ist das?!“, fragt Chris.
„Weiß nicht.“ Schulterzucken vom Big Boss.
„Wir wollten Seezunge.“ Diesmal Kathrin. Big Boss nickt heftig und bestätigend und ist heilfroh, seinen Teller doch noch loszuwerden.
Nur Moritz, der ist noch nicht vollkommen glücklich, denn auf seinem Teller thronen vier einsame Sepias auf einem riesigen Salatberg und es stellt sich unweigerlich die Frage, wie ein Zwei-Meter-Mann davon satt werden soll. Er besteht auf den ihm eingangs versprochenen „patates“. In Windeseile, gerade als er den letzten Salatbissen auf der Gabel hat, wird eine kleine Schale mit durchweichten Kartoffeln aufgefahren, die er sich brüderlich mit mir teilt.
Ich bin von dem Ganzen dermaßen angeheitert; ich brauche nicht einmal Alkohol. Und das ist auch gut so. Denn Big Boss (der sprachenlose Kellner traut sich längst nicht mehr an unseren Tisch) sorgt dafür, dass wir keine Fachidioten bleiben. Er räumt gekonnt und professionell ab, die Rechnung landet auf unserem Tisch und wir haben die Gelegenheit, unsere Mathematikkenntnisse unter Beweis zu stellen, indem wir sie auseinanderdividieren. Das klappt mit acht Personen bereits nach fünfundzwanzig Minuten.
Manche extrem froh, dass sie nicht verhungern mussten, andere extrem angetütert von den vielen Beschwichtigungsschnäpsen, die uns zwischendurch gereicht wurden, so sitzen wir im Taxi, und der Fahrer erklärt uns, dass der Laden, aus dem wir kommen, von Albanern geführt wird.
„Nette Leute.“
Titelbild: © iStock/sfe-co2