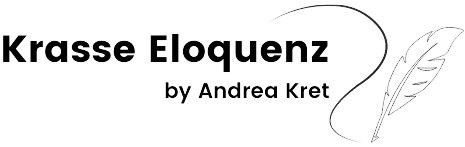Nach Stuttgart flog ich ganz klassisch von Hamburg-Fuhlsbüttel aus. Ganz und gar nicht klassisch war dabei die Uhrzeit: Um einen Tag Übernachtungskosten zu sparen, hatte mein Chef für diese Dienstreise einen Flug gebucht, der um 6.30 Uhr ging. Er dachte sich nichts dabei. Er wusste ja auch nicht, dass ich nicht ohne meinen riesigen alten Samsonite-Koffer, dessen Schloss schon durch diverse Zollbeamte geknackt worden war, sodass es seit Jahren nicht mehr richtig schloss, auf Reisen gehe. – Ja, das galt auch für eine dreitägige Abwesenheit.
Woher soll ich wissen, welches Wetter mich am Zielort erwartet? Und wenn doch nicht? Und woher sollte ich ahnen, in welcher Ankleidestimmung ich mich morgens in einer fremden Stadt befinden würde? Verstehen Sie? So klingelte mein Wecker pünktlich um 3 Uhr nachts, ich packte den Koffer voll und um 4.30 Uhr polterte das sperrige Gepäckstück durch die schwach beleuchtete Straße und weckte vermutlich den ein oder anderen Nachbarn auf. Irgendwo bellte ein Hund.
Ich überlegte, ob ich Angst haben müsste, so mutterseelenallein in dunkelster Nacht unterwegs zu sein, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Zu dieser Stunde schliefen selbst hartgesottene Verbrecher. Ich erreichte den S-Bahnhof und traf dort zu meinem Erstaunen auf eine kleine, lose Ansammlung von Menschen. Was war hier los? Wo wollten die hin?
„Was ist das für ein Menschenschlag“, dachte ich bei mir, „der es zu dieser Tageszeit für notwendig erachtet, auf den Beinen zu sein? Haben die eine Störung, einen genetischen Defekt?“ Ich studierte jeden Einzelnen von ihnen, bemerkte nichts Ungewöhnliches. Irgendeine Schraube musste bei denen locker sein, da war ich mir sicher, auch wenn sie lediglich zur Arbeit wollten.
Stuttgart war anders, so brav. Der Taxifahrer türkischer Abstammung hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch der Nebenmann fuhr 50. Bei uns in Hamburg wäre man ausgehupt worden, ausgelacht, ja: angepöbelt! Das Taxi setzte mich am kleinen, gemütlichen und wie ich feststellte christlichen Hotel ab, wo man an der Rezeption mit mir nichts anzufangen wusste. Was in Gottes Namen machte ich dort um diese unchristliche Zeit? Hatte ich kein Zuhause? Nein, darauf war man hier nicht eingestellt, ich solle zu einer ordentlichen Stunde wiederkommen, ja, das Gepäckstück könne ich dalassen.
Ich war erstaunlich fit, als ich den Seminarraum erreichte. „Techniken zur Förderung der Kreativität beim Übersetzen“ stand dort an der Tür. Von der Kursleiterin Stella Witzmacher, Fachreferentin des Übersetzerverbands, langjährige Chefredakteurin einer bekannten Zeitschrift für Übersetzer, erwartete ich eine Offenbarung. Als wenn sie es geahnt hätte, kam sie zu Anfang der Stunde mit dem Mindmapping um die Ecke, einer Technik, die wir bereits im ersten Semester des Germanistikstudiums durchgenommen hatten. Die Sache wurde nicht besser, als ich nach und nach die volle Bandbreite ihrer Redekunst kennenlernte. Inflationär oft fielen Sätze wie „Wenn wir hier ’nen Substantiv haben“ und „’nen Infinitiv an dieser Stelle ist ’ne feine Sache“. Sie fielen immer wieder – jedes Mal ein gezielter Treffer auf meinen Sprachnerv. Als sie zusätzlich „den Korpus“ erwähnte, machte ich mir ernsthaft Sorgen, Ohrenkrebs zu bekommen.
Unter den Teilnehmern entspann sich eine Diskussion darüber, ob man das „Schweizer“ in „Schweizer Währung“ groß- oder kleinschreiben müsse. Die Seminarleiterin zuckte mit den Schultern. Meine lektoratsfachkundige, zarte Bemerkung (inzwischen war ich doch etwas ermattet), dass dies großzuschreiben sei, wurde nicht beachtet. Man diskutierte weiter.
Mir war das alles zu blöd, ich wollte gehen. Just da hatte die Referentin plötzlich einen sachdienlichen Hinweis, was das Verfassen von kreativen Texten anging: Wenn man nicht weiterwusste beim Übersetzen, solle man aufstehen, sich etwas Leckeres zu essen kochen, um dann frisch und munter wieder ans Werk zu gehen.
Es wurde still im Raum. Ich gab Ohrensausen vor und verließ den Kurs.
Doch das übelste Seminar wird durch ein gelungenes Rahmenprogramm gerettet, diesmal im Vorfeld zusammengestellt von meinem Arbeitskollegen Konrad, seines Zeichens Musikliebhaber. Er schlug mir vor, in Stuttgart die Premiere von Rihms Kammeroper „Lenz“ aufzusuchen – ich würde es nicht bereuen. So stand ich pünktlich zur Öffnung vor dem Kassenhäuschen und dachte an eine Karte um die 50, 60 Euro. Ein hektischer Mittdreißiger lief die Schlange ab und wollte noch vor Verkaufsbeginn sein Ticket loswerden.
„Wie viel wollen Sie dafür?“, rief ich ihm zu. Er zeigte mir die Karte und darauf den Preis: 27 Euro.
„Zu billig“, sagte ich. Die Schlange lachte.
Ein anderer, grau melierter Herr, schritt ebenfalls die Reihe der Wartenden ab, kam nach dem Vorfall zielstrebig auf mich zu und erklärte mir, dass seine Frau krank sei und er deshalb zwei Karten abzugeben hätte. Ja, eine Karte wäre auch okay; er könne ohnehin nichts damit anfangen. Ich schaute auf den Preis: 80 Euro.
„Zu teuer“, sagte ich, rief ihn aber zurück, als er gehen wollte, bot ihm 60. Der Deal war besiegelt. Ich nahm glücklich mein Schnäppchen entgegen und saß wenig später in Reihe 15, Sitz 618. Ob die 620, der Nachbarsitz, wohl freibleiben würde? Nein, ein Mann, etwa in meinem Alter, nahm kurz darauf dort Platz. Ich musterte ihn.
„Na, Sie sind der andere?“
Fragender Gesichtsausdruck.
„Sie haben dem Herrn wohl ebenfalls eine Eintrittskarte abgekauft?“
Sein Blick hellte sich auf. Was er denn für seine Karte bezahlt hätte, fragte ich ihn neugierig.
„40 Euro.“
Oh.
„Ich 50.“
Ich begann eine Klagearie, dass ich dann ja wohl doch kein Schnäppchen geschossen hätte – und er sei ja so ein Glückspilz –, da drehte sich eine Frau aus der Reihe vor uns um: „Grämen Sie sich nicht. Die Plätze in Ihrer Reihe kosten 80 Euro. Da sind Sie mit 50 recht gut bedient. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte Ihr Gespräch mit angehört.“
Ich erzählte den beiden, dass ich in der fünften Reihe links Karl Lagerfeld in Begleitung einer älteren Damen erspäht hätte: lange graue Haare, zu einem Zopf zusammengebunden, rotes Jackett; so stellte ich mir in etwa den Modezaren von hinten vor.
„Unmöglich“, sagte die Frau vor uns. „Karl Lagerfeld und alte Dame – das passt nicht zusammen.“
Der Mann neben mir schien ebenso wenig überzeugt.
„Wir in Stuttgart sind viel zu provinziell. Karl Lagerfeld käme nicht auf die Idee, sich hierher zu verirren. Sind Sie übrigens auch Musikerin?“, fragte er beiläufig.
„Äh, nein, wieso? Ich bin Lektorin und mein Kollege hat für mich die Veranstaltung herausgesucht. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, und lasse mich überraschen.“
„Oha.“
Was dieses „Oha“ zu bedeuten hatte, erfuhr ich, als sich der Vorhang hob und ich eine Meteoritenlandschaft erblickte. Und einen halbnackten Menschen, der im Graben lag. Lenz.
Lenz beherrschte das Kunststück, innerhalb eines gesungenen Satzes – „Was hast-du-dage-ta-han?“ – mehrmals auf drastische Art die Tonhöhe zu wechseln. Außerdem brillierte er in der Disziplin des Sich-im-Schlamm-Suhlens und war zudem geübt in dem Sich-in-die-Hose-Machen. Wer angenommen hatte, dass Lenz ob seiner Verwirrtheit so wirr sang, wurde von den anderen Charakteren eines Besseren belehrt, die ganz und gar nicht depressiv, sondern düster und herrisch mit Leichtigkeit Tonstufen übersprangen, wie man es sonst nur von Steinböcken im Gebirge her kennt. Nur noch zehn musikalische Bilder. Noch neun. Am Ende Applaus ohne Ende. Mein Sitznachbar schlug seine Pranken aneinander. Sein Klatschen wurde noch lauter, als ein freundlicher, älterer Mann auf die Bühne kam. Kot hatte er nicht an seiner Kleidung – es konnte also keiner der Sänger sein.
„Rihm“, schrie mein Nachbar.
„Ach so!“ Der Komponist.
Ich legte zu beim Applaudieren.
So experimentell mein Abend begonnen hatte, so traditionell sollte er ausklingen: im „Alten Ochs’n“ in der Stuttgarter Innenstadt, wo ich mir eine Haxe mit Käsespätzle bestellte. Meinem zarten Wesen wurde eine gusseiserne Pfanne mit einem halben Ochsen und einem Berg Käsespätzle vorgesetzt. Nach erstem Zögern stürzte ich mich auf die Spätzle, die wirklich sehr schwäbisch schmeckten, probierte etwas von der Haxe, blieb schließlich doch bei den Teigwaren hängen, bis nur noch ein einsames Spätzel auf dem Teller lag. Das Fleisch ließ ich mir einpacken und sah mich bereits als Stuttgarter Mutter Teresa auf den Titelseiten der Bild-Zeitung prangen, die einem Obdachlosen ein großes, dampfendes Stück Fleisch überreichte. Ich irrte durch die dunklen Gassen auf der Suche nach einem Unglücklichen, um ihm meine noch warme Haxe in die Hände zu drücken, doch da war keiner, auch nicht in der nächsten und übernächsten Straße. Aber da hinten, da lag einer im Graben wie vorhin Rihm, Pardon: Lenz. Er hatte keinen Pappbecher vor sich aufgestellt. Das war mir zu suspekt; ich rauschte weiter und war vor meiner Unterkunft angelangt. Die ich schnell passierte. An der Ecke ließ ich die Haxe unauffällig im Mülleimer verschwinden, während sich die vorbeigehenden Partygänger wegen meiner Geheimnistuerei nach mir umdrehten.
Am nächsten Morgen, meinem letzten Tag in Stuttgart, lachte die Sonne und ich folgte dem Freizeittipp meines anderen Kollegen Jürgen: „Wenn du in Stuttgart bist, fahr in die Weinberge, Andrea.“
Leider hatte Jürgen vergessen zu sagen, wo die denn waren, die Weinberge, welche Bahn man nehmen müsse und überhaupt. Ich schmiss mich todesmutig in ein car2go mit Elektromotor, wollte „Weinberge“ ins Navi eintippen. Doch halt, erst den Motor starten. Voller Aufregung steckte in den Schlüssel ins Zündschloss; Sitz, Seitenfenster und Rückspiegel waren eingestellt. Ich drehte den Schlüssel nach rechts. Nichts passierte. Ich drehte den Schlüssel noch einmal, nicht zu lang, dann, als sich wieder nichts tat, noch länger. Nix. Schnell wieder zurückgedreht. Schlüssel rausgezogen, wieder reingesteckt. Nicht mal das kleinste Ruckeln des Fahrzeugs.
Nach dem Drücken des SOS-Knopfes probierte ich es gemeinsam mit dem Herrn aus dem Lautsprecher. Mit demselben Ergebnis. Wir betrieben Ursachenforschung und stellten nach zehn Minuten fest, dass der Wagen die gesamte Zeit an gewesen war. Das sei so bei Elektromotoren: Man hörte sie nicht. Mit zitternden Händen – ich war jahrelang nicht Auto gefahren – löste ich die Handbremse, und tatsächlich: Das Wunderding bewegte sich. Nun nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich rollte mit 20 km/h über die leere Hauptstraße; alles lief wunderbar. Bis zu der roten Ampel, die dafür sorgte, dass ich auf der Straße nun Mitfahrer bekam, die zum Sonntagskuchen bei der Oma wollten, und ganz nah auffuhren, um mir wegen meiner Trödelei ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich versuchte zu beschleunigen und hörte eine laute Stimme, die mich anwies, rechts abzubiegen, wenn ich tatsächlich mal das „Hotel Weinberg“ erreichen wollte: mein Navi.
Hinter mir Autos und dahinter zu allem Unglück noch die Tram. Ich fuhr weiter geradeaus, was mit einer Stimmattacke aus dem Lautsprecher quittiert wurde. Rechts solltest du abbiegen, du nordischer Depp und Sonntagsfahrer! Nassgeschwitzt schaffte ich es an der dritten Kreuzung, endlich abzubiegen, und traute mir nach fünf Minuten sogar zu, meine geballte Aufmerksamkeit von der Fahrbahn abzuziehen und das Fenster einen Spalt aufzumachen, um mir Frischluft zu verschaffen. Ich weiß nicht wie, aber schließlich erreichte ich eine ländlich anmutende Gegend und die Blechstimme, die mir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen war, befahl mir stehenzubleiben. Darauf pfiff ich und bog locker nach rechts ab, mitten in die Weinberge – jetzt hatte ich den Dreh raus. Den Protest aus dem Lautsprecher überhörte ich. Ich peste mit heruntergelassenem Fenster und heraushängendem Ellenbogen elektrisch summend durch die Weinberge, die Sonntagswanderer sprangen rechts und links zur Seite. Herrlich.
Den Abend verbrachte ich unspektakulär bei einem Gespräch mit dem Herrn vom SOS-Knöpfchen wegen der zuerst sich nicht öffnen wollenden, dann nicht schließen wollenden Heckklappe. Nach zehn Minuten wusste ich ungefähr, wie es ging, verstaute meinen sperrigen Koffer als treuen Begleiter aber doch lieber auf dem Beifahrersitz. Er füllte ihn komplett aus. Er war es auch, der mich zurückrief, als ich ihn wegen der hohen Ereignisdichte am Wochenende neben dem geparkten car2go stehenließ, um ins Flughafengebäude zu laufen: „Hey, du kannst mich nicht einfach hier stehenlassen – nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Nimm mich mit!“
Titelbild: © iStock/ximehS