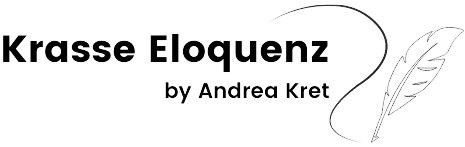„Wach auf, Agnieszka.“
Ich öffnete verschlafen die Augen und drückte Myszka, die rote Plüschmaus mit dem gelben Gummigesicht, deren rechtes Bein in der Fabrik falsch angenäht worden war und etwas abstand, fester an mich.
„Wach auf, wir fahren nach Deutschland.“
Nach Deutschland, dem Land, wo keine Zitronen blühen. Dafür der Dichter lebte, der über das Land der blühenden Zitronen schrieb. Sagen wir es ganz einfach: Ich war zehn und wir verließen Polen, um uns auf den Weg ins Schlaraffenland zu machen. Das Land, wo die Häuserdächer aus Lebkuchen waren und die Klinken aus Lübecker Marzipan.
Der vollbepackte kleine Fiat parkte vor der Tür. Die Oma hielt seit Mitternacht Wache am Fenster und schaute auf ihn hinunter. Sie gab meiner Mutter ein Zeichen: Alles in Ordnung, er ist noch da, nicht geklaut.
„Macht euch fertig, ich wache weiter.“
Nach der Verabschiedung der Oma („Agniesia, pass auf dich auf und schreib der Oma, wenn du in Deutschland bist“) schlüpfte ich auf den Beifahrersitz, neben dem Fahrersitz die einzige freie Fläche in dem bis zum Dach hin vollgestopften Auto. Wir brachen auf, bogen ab und die Oma war vergessen. Wir waren unterwegs nach Deutschland, wo mein Vater auf uns wartete; ich zappelte aufgeregt auf meinem Sitz herum. Diese Vorfreude wurde hinter Goleniów jäh ausgebremst. Erst roch es verbrannt, dann stank es, dann mussten wir anhalten – es ging nicht mehr weiter. Meine Mutter machte die Motorklappe hinten auf, es blubberte und spritzte.
„Oh, die Verschlusskappe für das Motoröl ist nicht mehr da“, erklärte sie mir, während sie einen Lappen holte, um ihre ölbeschmutzten Hände sauberzuwischen. Ich verstand das nicht, verstand aber, dass wir in der Tinte steckten. Verstand auch, dass meine Mutter die gesamte Fahrt über schwarze Hände haben würde, da Öl sich ohne heißes Wasser nicht abwischen ließ. Wie lustig. Langsam begaben wir uns zu Polmozbyt, der Reparaturwerkstatt. Die natürlich noch nicht aufhatte; es war ja erst 7 Uhr in der Früh. Wir parkten genau davor und vertrieben uns die Zeit mit dem Essen von belegten Brötchen, auf denen die Finger meiner Mutter dunkle Spuren hinterließen.
Der nette Mann von der Werkstatt, der fast pünktlich die Tore des Betriebs öffnete, wollte uns nach einem Blick auf den Motor davon überzeugen umzukehren.
„Sie schaffen das nicht mit der Kiste“, erklärte er meiner Mutter. „Fahren Sie zurück nach Hause.“ Doch die fünf Jahre, die sie darauf verwendet hatte, eine Ausreisegenehmigung zu beantragen und schließlich zu erhalten, sollten nicht umsonst gewesen sein. Sie bestand darauf, dass er ihr eine neue Verschlusskappe gab, und wir düsten davon. Die Grenze zur DDR war nicht weit – dort reihten wir uns in die Schlange der wartenden Autos ein. Schön waren sie, die Autos: groß, geräumig, sauber. Wir mit unserer ölverschmierten gelben Rumpelkiste, pechschwarzen Händen, Apfelgehäusen auf dem Cockpit und zerknülltem Butterbrotpapier auf dem Boden, die alle ein bildhaftes Zeugnis von der Neun-Stunden-Fahrt über polnische Landstraßen ablegten, mittenmang – wir waren ja in der Nähe von Berlin. Nur noch vierzig Pkw vor uns, meine Mutter bereitete die Papiere vor und die Liste, die sie für das Zollamt in Gdańsk angefertigt hatte.
„Bitte machen Sie eine Aufstellung darüber, was Sie beabsichtigen auszuführen“, hatte man dort zu ihr gesagt, um ihr die Reise noch auf der letzten Etappe zu erschweren. Man hatte es so dahingesagt und nicht damit gerechnet, dass meine Mutter den Auftrag penibelst ausführen würde: Pah, ihre leichteste Übung.
Der Grenzbeamte hielt die fünf DIN-A4-Blätter in den Händen und murmelte vor sich hin: „… drei Pullover (blau, grün, grün), eine Strickjacke (ins Braune gehend), zwei Paar Hausschuhe, ein Notizblock, vier Packungen Taschentücher, ein Handspiegel, ein Feuerzeug, eine Zigarettenschachtel der Marke Klubowe, ein Schlumpf und eine Schlumpfine, ein Netz – ein Netz?!“ Er wandte sich an uns. „Was hat es mit dem Netz auf sich?“
„Das Fischernetz haben wir im Spielwarengeschäft Pikuś in Sopot gekauft und meine Tochter hängt sehr daran“, erklärte meine Mutter. „Und der Stein“, sie zeigte auf den Drei-Kilo-Stein, der auf dem Rücksitz saß, „ist aus den Beskiden. Davon hat sie sich nicht trennen wollen.“
„… ein Keramikelefant, ein Draht mit einer blauen Kugel dran“, fuhr der Beamte fort und blickte hoch. „Ach, wissen Sie was – ist schon in Ordnung. Fahren Sie durch.“
Endlich in Deutschland! Wenn noch nicht im richtigen. Für den nächsten Streckenabschnitt durch Ostdeutschland hatten wir von meinem Onkel Staszek einen heißen Tipp bekommen: Es sei völlig hirnrissig, den Riesenschlenker über Berlin zu machen, wenn es auch einfacher ging – mit einer Abkürzung. Er riet uns, die Autobahn zu meiden, und nannte einige Zwischenstopps in Ostdeutschland, an denen wir uns orientieren sollten. Eine Abkürzung führe deutlich schneller ans Ziel. Er mache das immer so. Gleich hinter der Grenze, bei Gramzow, verließen wir die Autobahn und fanden uns in einem Dorf wieder, das nicht auf unserer Karte verzeichnet war. Kopfsteinpflaster, Pferdeäpfel, Heu lag hier und da auf der Straße. Ich glaube, nicht mal in Ostdeutschland selbst war bekannt, dass dieser Ort existierte. Die Dorfbewohner standen an den Zäunen und musterten uns mit Interesse. Sie beobachteten das unsicher nach vorn kriechende Fahrzeug, staunten, glotzten – und wahrten die nötige Distanz. Der Wagen knatterte zaghaft einige Meter weiter, dann drückte meine Mutter auf die Bremse. Es hatte keinen Zweck; wir wussten nicht, wo es langging. Auf einem Hof reparierte ein Bauer seinen Trecker, legte das Werkzeug beiseite, als wir vor seinem Zaun hielten, und kam auf uns zu. Meine Mutter schwenkte die Karte aus dem Spielzeugladen Pikuś vor seiner Nase: „Hamburg, Hamburg.“
Seine Antwort war präzise und an sich unmissverständlich: „Autobahn.“
Was „Bahn“ hieß, wusste meine Mutter. Wieso kam der gute Mann darauf, dass wir Bahn fahren sollten? Sah er das Fahrzeug nicht?! Meine Mutter schüttelte heftig den Kopf: „Nein, nein, Auto.“ Sie zeigte auf den Wagen. Er wiederholte nur „Autobahn“. Es hatte keinen Sinn, mit ihm weiterzudiskutieren – allmählich wurde es heikel. Wir befanden uns auf der Transitstrecke. Größere Stopps waren von Behördenseite nicht vorgesehen und wurden sanktioniert. Meine Mutter bedeutete mir einzusteigen, wendete den Wagen und machte sich schleunigst auf den Weg zurück zur Strecke, die ursprünglich geplant war. Wir beschleunigten von null auf hundert in nur drei Minuten und mussten uns festkrallen, meine Mutter am Lenkrad, ich am Seitengriff – der Wagen war dabei abzuheben, es rumpelte in jeder Ecke, der Lärm war ohrenbetäubend, die Rakete startklar. Bald würde ein Countdown ertönen: ten, nine, eight … Meine Mutter drosselte das Tempo, damit doch noch die Chance bestand, dass wir am Ende heil ankamen und der Wagen nicht zwischenzeitlich auseinanderfiel, und blieb bis zur deutsch-deutschen Grenze bei soliden 75 Stundenkilometern. Der ostdeutsche Zollbeamte beäugte uns argwöhnisch, schaute in den Wagen, lief darum herum, ging davon, kam zurück, klopfte hier, schob da, inspizierte die Unterseite des Gefährts mit einem kleinen Spiegel, an einer Stange befestigt, und drückte meiner Mutter drei Formulare in die Hand.
„Ausfüllen.“
Puh, das war gar nicht so einfach. Vorname, Nachname, Mädchenname, Zuname. Hm, „Name“, ja, das kam meiner Mutter bekannt vor. Aber Vorname, Nachname, Mädchenname? Und Zuname! Was hatte das alles zu bedeuten? Von den Nachbarn in Sopot wusste sie, dass in deutschen Formularen alles gewissenhaft auszufüllen sei; also schrieb sie in jedes Feld ihren Namen, den Namen ihrer Mutter und den ihres Vaters hinein: Grażyna Kret, Czesława Pomorska, Wiesław Pomorski. Und noch einmal: Grażyna Kret … Im folgenden Feld ebenso. Und weil es so gut lief, auch im nächsten. Bis in jedem umrandeten Kasten zu lesen war: Grażyna Kret, Czesława Pomorska – na, Sie wissen schon. Der Beamte begutachtete die Vordrucke, verzog keine Miene, nickte kurz und ordnete an: „Weiterfahren.“ Was sich für uns ungefähr so anhörte wie „Stehenblieben, Hände hoch“, das man in den beliebten polnischen Filmen zum Zweiten Weltkrieg hörte. Zu Befehl!
Wir passierten den zweiten Grenzposten, diesmal auf der westlichen Seite, wo man uns freundlich-entspannt durchwinkte, und setzen die Fahrt Richtung Hamburg fort. Und derweil wir 30 Kilometer die Stunde vor uns hinkrochen, überholte uns ein Fahrzeug nach dem anderen. Man hupte und winkte fröhlich, kurbelte sogar die Scheibe herunter und rief uns etwas zu. Nein, eine Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung hatte es eindeutig nicht gegeben. Meine Mutter hat nichts gesehen und ich hatte eher auf die lockeren Jungs von der westdeutschen Grenze zurückschaut und sie mir in Liegestühlen, Reggae hörend, auf Hawaii vorgestellt. Wir tuckerten unbeirrt mit 30 km/h und ließen uns weitere nonverbale Aufmerksamkeitsbekundungen zukommen. Nett waren sie, die Deutschen.
Langsam wurde es doof. Ich war hundemüde. Am Autobahnrand nur Wald, wohin das Auge blickte.
„Hier ist nur Wald. Hier gibts gar nichts! Ich will zurück in die Stadt. Ich will wieder nach Sopot.“
„Beruhig dich“, beschwichtigte mich meine Mutter. „Hamburg ist eine große Stadt. Viel größer als Sopot.“ Allmählich kamen auch ihr Zweifel, denn auch sie sah seit Stunden nichts als Wald. Und ständig dieses Schild: „Ausfahrt“. Einige Kilometer weiter wieder: „Ausfahrt“.
„Agnieszka, such auf der Karte nach ‚Ausfahrt‘. Das muss eine große Stadt sein.“
„Gibt es nicht!“, verkündete ich.
„Das kann nicht sein, schau noch mal genau. Ich kann jetzt nicht anhalten. Das muss was Großes sein, wenn so viele Schilder darauf verweisen.“
„Gibt es aber nicht!“, wiederholte ich trotzig und gähnte einmal. Es war mittlerweile dunkel geworden, ich war wirklich schläfrig und wollte nach Hause. Geschlagene zwölf Stunden waren wir unterwegs; inzwischen wieder mit Tempo 75. Meine Mutter drehte das Radio auf, kurbelte das Fenster herunter – auch sie war ermattet und wollte eigentlich nur noch nach Hause. Und hatte Angst einzuschlafen. Der Luftzug und die Musik machten es nicht besser.
„Agnieszka, rede mit mir!“
„Will nicht reden!“
„Rede mit mir, sonst schlafe ich ein.“
„Ich will aber nicht. Ich will zurück nach Sopot!“
Nach einem Hin und Her sah ich ein, dass ich nicht umhinkam, wenigstens einsilbige Antworten auf die immer abstrakter werdenden Fragen meiner Mutter zu geben. „Weiß nicht. Ja, vielleicht.“ Irgendwie kam ich damit durch.
Und dann endlich die Abfahrt Hamburg-Jenfeld.
„Egal, die nehmen wir“, sagte meine Mutter und fuhr ab. Hamburg war uns schon mal sicher. Den Rest würden wir improvisieren. Wir parkten direkt hinter der Abfahrt – wo es ebenfalls Richtung „Ausfahrt“ gegangen war – auf einem Seitenstreifen. Daneben gleich eine Telefonzelle. Kleingeld hatte meine Mutter sich im Vorfeld besorgt und rief den Kumpel meines Vaters an, der im Gegensatz zu ihm stolzer Besitzer eines Festnetzanschlusses war: „Hallo Herr Przemysław, wir sind hier in irgendeinem Hamburg-Jenfeld – was sollen wir tun?“
Während sie mit Herrn Przemysław sprach, sah ich mir den Bürgersteig an, der so neu, so eben, so anders war und sogar einen zusätzlichen Streifen hatte. Sachen gabs … Ich lief aus dem Telefonhäuschen, um ihn mir genauer anzuschauen, hörte beim Hinauslaufen, wie Herr Przemysław sagte, er wüsste nichts, er hätte keine Zeit und Tschüss.
„Mensch, was sollen wir machen“, sagte meine Mutter mehr zu sich selbst, während ich völlig in meiner Bürgersteigfaszination aufging. Sie hingegen war nicht ganz so bürgersteigaffin, stellte sich eher Fragen wie: „Wo in Gottes Namen waren wir gelandet?“ Kein Hinweisschild weit und breit. Immerhin hatte sie Herrn Przemysław abgerungen, dass „Ausfahrt“ ein anderes Wort für „Autobahnabfahrt“ war und nicht – wie in Polen – auf die Stadt hinwies, zu der es ging.
„Geh zum Wagen und bleib dort, damit ihn keiner klaut, ich mache mich auf die Suche nach einem Straßenschild.“
„Will aber nicht zum Wagen“, protestierte ich und blieb demonstrativ stehen. Auf dem Bürgersteig. So durfte ich mit. Ganz, ganz hinten an der Kreuzung, da war tatsächlich ein Straßenschild, beschriftet mit „Elfsaal“.
„Was steht auf deinem Zettel?“ Meine Mutter schaute mich an. Der lag im Wagen. Wir stapften zurück und lasen: „Elfsaal 13 a“.
Die Freude, die vorherrschte, als wir die Klingel am Namensschild für Kret in der Straße Elfsaal, Nummer 13 a, betätigten, überlasse ich der Fantasie des geneigten west- oder ostdeutschen Lesers.
Titelfoto: © iStock/mekcar